Melde dich jetzt für die Warteliste an.
Für Warteliste anmelden
Für Warteliste anmelden

Die Hybrid-Methode kombiniert zwei Ansätze, um Scope-3-Emissionen präzise und effizient zu berechnen: aktivitätsbasierte Daten, die detaillierte Einblicke ermöglichen, und ausgabenbasierte Schätzungen, die vorhandene Finanzdaten nutzen. Diese Methode hilft euch, Datenlücken zu schließen und den CO₂-Fußabdruck entlang eurer Lieferkette besser zu verstehen.
Warum ist das wichtig?
Scope-3-Emissionen machen oft bis zu 90 % des gesamten CO₂-Ausstoßes eines Unternehmens aus. Mit der Hybrid-Methode könnt ihr:
Wie funktioniert das in der Praxis?
Die Hybrid-Methode ist besonders geeignet, wenn ihr bereits über einige spezifische Daten verfügt, aber noch Lücken schließen wollt. Mit einer klaren Strategie und Technologie wie KI-gestützten Tools könnt ihr eure Emissionsmessung deutlich verbessern.
Die Hybrid-Methode vereint zwei Ansätze: Sie kombiniert spezifische Aktivitätsdaten von Lieferanten mit ergänzenden sekundären Daten, um Emissionen genauer zu berechnen. Dabei wird die Genauigkeit der aktivitätsbasierten Methode genutzt, wo detaillierte Informationen verfügbar sind, und durch ausgabenbasierte Schätzungen ergänzt, wenn solche Daten fehlen.
Die Berechnung erfolgt durch die Erfassung der Daten aus beiden Ansätzen, die anschließend mit passenden Emissionsfaktoren multipliziert werden, um die Gesamtemissionen zu ermitteln.
Ein Beispiel aus der Praxis: Ein international tätiges Unternehmen sammelt für Geschäftsreisen präzise aktivitätsbasierte Daten, etwa zu Flugrouten und Entfernungen. Liegen solche Daten nicht vor, werden stattdessen Finanzdaten wie Reisekosten herangezogen und mit ausgabenbasierten Faktoren berechnet.
Im nächsten Schritt entscheiden Unternehmen, in welchen Bereichen diese Methode am sinnvollsten eingesetzt werden kann.
Die Hybrid-Methode ist besonders nützlich, wenn bereits einige lieferantenspezifische Daten vorliegen, aber noch Lücken bestehen. Sie bietet sich an, wenn ein Lieferant nur wenige oder sehr ähnliche Produkte herstellt oder wenn ein allgemeiner, ausgabenbasierter Emissionsfaktor durch spezifischere Werte ersetzt werden soll.
Scope-3-Emissionen stellen oft den größten Anteil des gesamten CO₂-Fußabdrucks eines Unternehmens dar – in manchen Fällen bis zu 90 %. Daher ist es entscheidend, diese möglichst präzise zu erfassen.
Die Hybrid-Methode ermöglicht eine effiziente Nutzung der verfügbaren Ressourcen: Bei wichtigen Lieferanten können detaillierte Aktivitätsdaten erhoben werden, während bei kleineren Lieferanten auf ausgabenbasierte Schätzungen zurückgegriffen wird. Unternehmen können zunächst mit der ausgabenbasierten Methode starten und schrittweise auf aktivitätsbasierte Daten umstellen, um frühzeitig mit der Emissionsmessung zu beginnen.
Allerdings ist die Methode weniger genau, wenn sie nicht bei den richtigen Lieferanten angewendet wird. Daher ist es sinnvoll, frühzeitig den Kontakt zu Lieferanten zu suchen und klare Vorgaben zu den benötigten Daten zu machen.
Auch die Anforderungen an die Berichterstattung spielen eine wichtige Rolle. Das GHG-Protokoll empfiehlt, Methoden zu wählen, die sicherstellen, dass das Emissionsinventar die Treibhausgasemissionen der Aktivitäten korrekt abbildet und sowohl internen als auch externen Informationsbedürfnissen gerecht wird.
Das GHG-Protokoll definiert 15 Kategorien, von denen jedoch nur einige für jedes Unternehmen von Bedeutung sind. Die Auswahl der relevanten Kategorien ist der erste und entscheidende Schritt, um die Hybrid-Methode erfolgreich anzuwenden.
Zu Beginn steht eine Relevanzbeurteilung, die festlegt, welche der 15 Kategorien für das Unternehmen wichtig sind. Das GHG-Protokoll empfiehlt, den Fokus auf Kategorien zu legen, die erhebliche Treibhausgasemissionen verursachen, Potenzial für Reduktionen bieten und eng mit den Unternehmenszielen verknüpft sind.
Dabei sollten Faktoren wie Emissionsvolumen, Risiken, Erwartungen von Stakeholdern, Outsourcing und branchenspezifische Leitlinien berücksichtigt werden. Um die Relevanz einzelner Kategorien zu bewerten, ist es hilfreich, die Beschreibungen im Scope-3-Standard durchzugehen und Experten innerhalb des Unternehmens einzubeziehen.
In manchen Fällen kann eine vorläufige Emissionsschätzung notwendig sein, um die Bedeutung einer Kategorie anhand ihrer Emissionsgröße zu bewerten. Da Scope-3-Emissionen oft den größten Anteil der gesamten Treibhausgasemissionen eines Unternehmens ausmachen, ermöglicht eine umfassende Analyse, die Bereiche mit dem größten Einsparpotenzial zu identifizieren.
Nach der Identifikation der relevanten Kategorien folgt der nächste Schritt: die gezielte Sammlung und Validierung von Daten.
Die Qualität der Daten ist entscheidend für den Erfolg der Hybrid-Methode. Unternehmen müssen sowohl Primärdaten von Lieferanten als auch Sekundärdaten erfassen und deren Verlässlichkeit sicherstellen.
Zunächst sollte geprüft werden, ob die von Lieferanten bereitgestellten Daten vollständig, zeitlich konsistent und überprüfbar sind. Diese Prüfung hilft, die Qualität der Daten einzuschätzen und mögliche Schwachstellen zu erkennen.
Die Einbindung von Führungskräften aus Bereichen wie Logistik, Lieferkette und Finanzen ist dabei essenziell. Diese Abteilungen haben oft direkten Kontakt zu Lieferanten und können den Prozess der Datensammlung unterstützen.
Ein Beispiel: Ikea erhebt Daten sowohl von Tier-1- als auch von Tier-2-Lieferanten, um ein möglichst umfassendes Bild der Scope-3-Emissionen zu erhalten.
Transparenz spielt eine zentrale Rolle, um das Vertrauen der Stakeholder in die bereitgestellten Informationen zu stärken. Alle zwischen Unternehmen und Lieferanten ausgetauschten Daten sollten auf Genauigkeit und Vollständigkeit überprüft werden. Zudem ist es wichtig, die Datenquellen, Berechnungsmethoden, Emissionsfaktoren und zugrunde liegenden Annahmen sorgfältig zu dokumentieren.
Basierend auf den Prinzipien der Hybrid-Methode werden die gesammelten Daten kombiniert. Die Verknüpfung von Primär- und Sekundärdaten erfordert eine durchdachte Herangehensweise, um die Vorteile beider Datentypen optimal zu nutzen.
Primärdaten, die direkt aus den betrieblichen Abläufen stammen, bieten die höchste Genauigkeit. Sekundäre, branchenspezifische Daten hingegen ermöglichen eine kosteneffiziente Ergänzung. Die Priorisierung der Primärdaten sollte sich auf Emissionsquellen konzentrieren, die einen wesentlichen Beitrag zum CO₂-Fußabdruck leisten.
In der Praxis sammelt die Hybrid-Methode Scope-1- und Scope-2-Emissionsdaten direkt von Lieferanten. Upstream-Emissionen werden anhand spezifischer Aktivitätsdaten der Lieferanten berechnet – hierzu zählen Materialien, Kraftstoffe, Strom, Transport und Abfall, die mit entsprechenden Emissionsfaktoren multipliziert werden.
Unternehmen sollten standardisierte Prüfverfahren für die Qualität sowohl von Primär- als auch von Sekundärdaten einführen. Die Offenlegung des Anteils der mit Sekundärdaten berechneten Emissionen, insbesondere im Bereich Scope-3, sorgt für zusätzliche Transparenz.
„Eine übermäßige Abhängigkeit von sekundären Daten kann die Glaubwürdigkeit Ihrer Berichterstattung untergraben, während die ausschließliche Verwendung von Primärdaten ressourcenintensiv und unpraktisch sein kann".
Die Wahl der Berechnungsmethode sollte sicherstellen, dass das Emissionsinventar die tatsächlichen Treibhausgasemissionen präzise widerspiegelt und sowohl interne als auch externe Anforderungen erfüllt. Innerhalb einer Kategorie können dabei unterschiedliche Methoden für verschiedene Aktivitäten angewendet werden.
Die Hybrid-Methode kombiniert Top-down-Modelle mit Bottom-up-Daten und ermöglicht so eine umfassende und effiziente Erfassung von Scope-3-Emissionen. Diese Herangehensweise bietet eine vollständige Übersicht über den gesamten CO₂-Fußabdruck, während gleichzeitig die Messung auf die relevanten Bereiche konzentriert wird.
Ein großer Pluspunkt ist die umfassende Abdeckung der Emissionen. Während Bottom-up-Daten detaillierte Einblicke in spezifische Emissions-Hotspots liefern, sorgt die Methode gleichzeitig für einen Überblick über die gesamten Emissionen entlang der Wertschöpfungskette. Das ist besonders wichtig, da weniger als 10 % der Unternehmen ihre Scope-3-Emissionen präzise und vollständig messen .
Ein weiterer Vorteil liegt in der effizienten Nutzung von Ressourcen. Die Datenerhebung für Scope-3-Emissionen kann gezielt auf die Bereiche fokussiert werden, die die meisten relevanten Erkenntnisse liefern, anstatt Ressourcen breit zu streuen. Zudem ermöglicht die Methode eine schrittweise Optimierung: Detaillierte Bottom-up-Analysen können sukzessive erweitert werden, um mit wachsender Datenbasis immer größere Teile des Emissionsfußabdrucks abzudecken.
Die Flexibilität der Hybrid-Methode ist ebenfalls hervorzuheben. Sie kann an veränderte Unternehmensbedingungen, neue Datenquellen, Compliance-Vorgaben und Zielsetzungen angepasst werden. Diese dynamische Anpassungsfähigkeit bietet Unternehmen langfristige Planungssicherheit.
Darüber hinaus liefert die Methode konkrete Ansätze zur Reduktion von CO₂-Emissionen. Die gewonnenen Einblicke unterstützen gezielte Maßnahmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von Tier-1-Lieferanten über Beschaffungsausgaben und Logistik bis hin zum Produktdesign. Doch trotz dieser Vorteile bringt die Umsetzung der Hybrid-Methode auch Herausforderungen mit sich.
Trotz der Stärken der Hybrid-Methode gibt es in der Praxis einige Stolpersteine. Eine zentrale Herausforderung ist die Beschaffung detaillierter Emissionsdaten von Lieferanten. Oft sind Lieferanten zurückhaltend, operative Details preiszugeben, insbesondere wenn keine finanziellen Anreize oder Compliance-Vorgaben bestehen.
Die Lösung liegt in einer kooperativen Herangehensweise. Unternehmen sollten mit ihren Lieferanten partnerschaftlich zusammenarbeiten und Unterstützung anbieten, statt nur Daten einzufordern. Klare Kommunikation und ein Bewusstsein für die Bedeutung zuverlässiger Daten sind dabei essenziell.
Ein weiteres Hindernis ist die Integration unterschiedlicher Datenformate aus internen und externen Quellen. Unterschiedliche Berichtspflichten von Institutionen erhöhen die Komplexität zusätzlich. Unternehmen müssen entweder bestehende Systeme anpassen oder neue entwickeln, um Emissionsdaten präzise zu erfassen und zu berichten.
Die Sicherstellung einer konsistenten Datenqualität ist ebenfalls eine Herausforderung. Es bedarf rigoroser Qualitätssicherungsprozesse, um die Relevanz, Vollständigkeit und Genauigkeit der Daten zu gewährleisten. Standardisierte Prüfverfahren für Primär- und Sekundärdaten sind unverzichtbar, um die Glaubwürdigkeit der Berichterstattung sicherzustellen.
Die detaillierte Datenerhebung, etwa durch Lebenszyklusanalysen und Lieferantenbefragungen, erfordert langfristige Planung und ein entsprechendes Budget. Unternehmen sollten dabei schrittweise vorgehen und flexible Tools sowie Modelle einsetzen, die bei Bedarf angepasst werden können, wenn sich Geschäftsbedingungen, Emissionsfaktoren oder Datengrundlagen ändern.
Auch der Ressourcenbedarf stellt eine praktische Hürde dar. Zusätzliche Mitarbeiter und Ausgaben können eine Belastung sein. Unternehmen sollten daher in Betracht ziehen, zusätzliches Personal einzustellen, in ESG-Software zu investieren oder externe Beratungsdienste in Anspruch zu nehmen.
Schließlich erfordert die regelmäßige Aktualisierung und Anpassung der Datenströme eine sorgfältige Planung und Koordination. Veränderungen in Geschäftskennzahlen, Betriebsabläufen, Klimawissenschaft und Emissionsfaktoren können eine Neukalibrierung der hybriden Modelle notwendig machen, um deren Genauigkeit langfristig zu gewährleisten.
Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen kann die CO₂-Bilanzierung deutlich effizienter gestalten, insbesondere bei der Anwendung der Hybrid-Methode. Diese Technologien beschleunigen die Datenerfassung und Berechnung erheblich und vereinfachen die komplexen Prozesse, die mit dieser Methode einhergehen.
Moderne Software-Plattformen übernehmen dabei zentrale Aufgaben: Sie automatisieren die Datensammlung, integrieren Emissionsfaktoren und erstellen anpassbare Berichte. Das ist besonders wichtig, da Scope-3-Emissionen in vielen Branchen bis zu 90 % der gesamten Emissionen eines Unternehmens ausmachen.
Ein konkretes Beispiel für den Nutzen von KI ist die automatische Zuordnung von Emissionsfaktoren auf Transaktionsebene in Ausgabenübersichten. Dieser Ansatz minimiert manuelle Arbeitsschritte und sorgt gleichzeitig für präzisere Ergebnisse. Darüber hinaus ermöglicht die Technologie Unternehmen, schrittweise von einer ausgabenbasierten zu einer detaillierteren, aktivitätsbasierten Bilanzierungsmethode überzugehen, sobald spezifischere Daten verfügbar sind.
Auch die Berichterstattung profitiert: Automatisierte Funktionen helfen, regulatorische Vorgaben zu erfüllen und Fortschritte klar und nachvollziehbar an Stakeholder zu kommunizieren. Dies ist insbesondere für die Anforderungen der CSRD-Berichterstattung relevant, bei der Unternehmen ihre gesamten Treibhausgasemissionen in CO₂-Äquivalenten angeben und sowohl Baseline-Emissionen als auch Reduktionsziele dokumentieren müssen.
Bei der Auswahl einer geeigneten Software sollten Unternehmen darauf achten, dass die Plattform verschiedene Bilanzierungsmethoden unterstützt – von ausgabenbasierten über aktivitätsbasierte bis hin zu hybriden Ansätzen. Zudem sind flexible Import-Funktionen und Werkzeuge zur Datenumwandlung entscheidend, um auch mit uneinheitlichen Datenformaten arbeiten zu können. Solche Funktionen lassen sich ideal in modernen Plattformen umsetzen – wie im folgenden Abschnitt gezeigt wird.
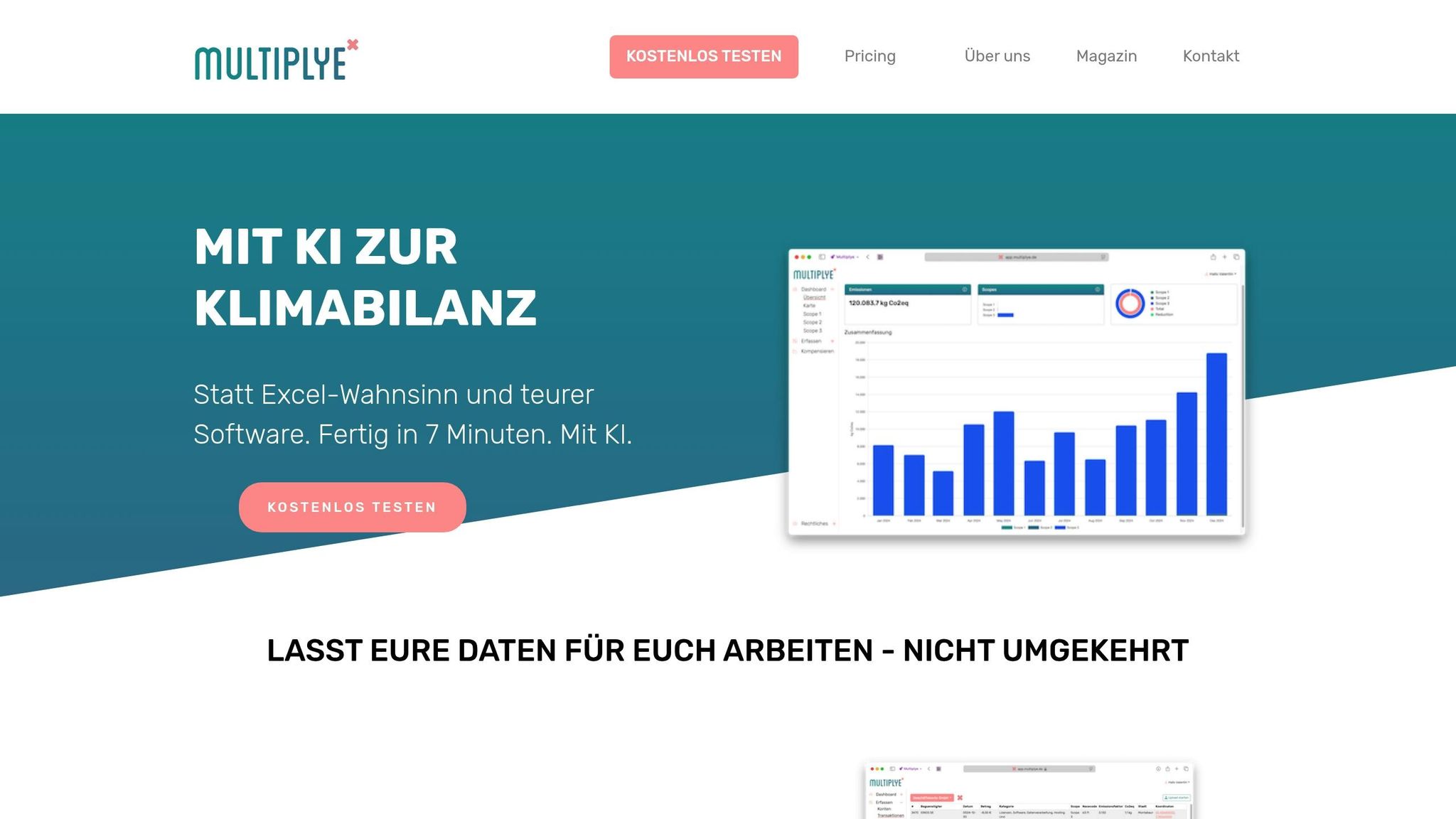
Die Plattform MULTIPLYE wurde speziell für die Anforderungen der hybriden Scope-3-Bilanzierung entwickelt und bietet eine umfassende, automatisierte Lösung. Mithilfe von KI-gestützten Analysen ermöglicht sie eine schnelle und präzise Auswertung von Emissionsdaten und ordnet CO₂e-Werte den entsprechenden Scopes zu.
Ein Highlight der Plattform ist die Kombination verschiedener Datenquellen, die es ermöglicht, eine intuitive Heatmap der CO₂e-Bilanz zu erstellen. Diese Heatmap hilft Unternehmen, Emissions-Hotspots entlang ihrer Wertschöpfungskette zu identifizieren. Zusätzlich können mit der KI-basierten Analyse auch rückwirkende CO₂e-Bilanzen für vergangene Jahre erstellt werden – ein entscheidender Schritt, um eine solide Ausgangsbasis zu schaffen.
Ein weiterer Vorteil von MULTIPLYE ist die geografische Übersicht der Geschäftsverbindungen, die eine einfache Bewertung von Klimarisiken ermöglicht. Diese Funktion unterstützt die hybride Methode optimal, da sie sowohl Top-down-Modelle als auch Bottom-up-Daten integriert und so eine umfassende Sicht auf die gesamte Lieferkette bietet.
Darüber hinaus ermutigt die Plattform Unternehmen, den Ansatz „Prototyp und Lernen“ zu verfolgen. Dieser Ansatz hilft dabei, die beste Strategie für die spezifischen Anforderungen der eigenen Lieferkette zu entwickeln. Mit sicherem Datenhosting in Deutschland und der Einhaltung der EU-Nachhaltigkeitsvorschriften können Unternehmen erste Testläufe ihrer CO₂-Bilanzierungsprozesse durchführen und sich so optimal auf den ersten offiziellen Berichtszyklus vorbereiten.
Die Hybrid-Methode hat sich als ein zuverlässiger Ansatz für die Berechnung von Scope-3-Emissionen bewährt. Durch die clevere Kombination von Top-down-Emissionsmodellen und detaillierten Bottom-up-Datenanalysen ermöglicht sie eine umfassende und präzise Bewertung der Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Dieser Ansatz verbindet allgemeine Top-down-Benchmarks mit spezifischen Bottom-up-Daten, was nicht nur eine effiziente Ressourcennutzung, sondern auch eine hohe Genauigkeit bei der Messung sicherstellt. Gerade diese Kombination macht sie zur präzisesten Methode für die CO₂-Bilanzierung, da sie die Vorteile beider Ansätze optimal vereint. Die Verbindung beider Perspektiven sorgt für konsistente und funktionsübergreifende Inventare, die als solide Basis für technologische Weiterentwicklungen in der CO₂-Bilanzierung dienen.
KI-gestützte Plattformen wie MULTIPLYE bringen zusätzlichen Nutzen, indem sie komplexe Berechnungen automatisieren und verschiedene Datenquellen nahtlos integrieren. Dies ist besonders wichtig, da weniger als 10 % der Unternehmen ihre Scope-3-Emissionen bisher umfassend und präzise messen. Solche Tools liefern zudem intuitive Visualisierungen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsziele gezielt und effizient zu erreichen.
Diese Ansätze bieten Unternehmen klare Möglichkeiten, ihre Dekarbonisierungsstrategien erfolgreich umzusetzen. Die Hybrid-Methode in Kombination mit moderner Technologie ist dabei der Schlüssel. Sie gewährleistet nicht nur die notwendige Genauigkeit, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen, sondern schafft auch die Grundlage für gezielte Maßnahmen zur Emissionsreduzierung und langfristige Erfolge im Bereich Nachhaltigkeit.
Die Hybrid-Methode vereint verschiedene Ansätze, um die Berechnung von Scope-3-Emissionen genauer und flexibler zu gestalten. Sie kombiniert aktivitätsbasierte Daten, lieferantenspezifische Informationen und sekundäre Datenquellen, um ein möglichst vollständiges Bild der Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu schaffen.
Im Gegensatz zu rein datenbasierten oder standardisierten Verfahren passt sich die Hybrid-Methode besser an die individuellen Strukturen eines Unternehmens und die Besonderheiten der Lieferkette an. Dadurch lassen sich die tatsächlichen Emissionen präziser abbilden, was Unternehmen dabei unterstützt, gezielte Maßnahmen zur Reduktion zu planen und umzusetzen.
Die Hybrid-Methode zur Berechnung von Scope-3-Emissionen bringt einige Herausforderungen mit sich. Die Komplexität von Lieferketten, unvollständige Daten oder der hohe Zeit- und Kostenaufwand können die Umsetzung erschweren. Hinzu kommt, dass unterschiedliche Berechnungsmethoden die Situation zusätzlich komplizieren können.
Doch es gibt Wege, diese Hürden zu überwinden. Standardisierte Ansätze, eine bessere Datenqualität und gezielte Schulungen sind entscheidende Schritte in die richtige Richtung. Auch klare Richtlinien und eine enge Zusammenarbeit mit euren Lieferanten können die Datenerfassung vereinfachen und die Genauigkeit der Berechnungen deutlich verbessern.
Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und Automatisierung steigert die Effizienz der Hybrid-Methode erheblich. Diese Technologien übernehmen die automatisierte Verarbeitung großer Datenmengen, wodurch Fehlerquellen reduziert und wertvolle Zeit gespart wird.
KI-gestützte Analysen liefern zudem genauere Ergebnisse und ermöglichen fundierte Vorhersagen. Damit können Unternehmen ihre Scope-3-Emissionen präziser berechnen und gezielte Maßnahmen zur Reduzierung umsetzen. Das hilft nicht nur dabei, die EU-Vorgaben zur Nachhaltigkeit einzuhalten, sondern trägt auch zur Verbesserung der gesamten CO₂-Bilanz bei.