Melde dich jetzt für die Warteliste an.
Für Warteliste anmelden
Für Warteliste anmelden

Carbon Leakage – ein Begriff, der beschreibt, wie Unternehmen Treibhausgasemissionen von Regionen mit strengen Klimaschutzauflagen in Länder mit lockereren Vorgaben verlagern. Für deutsche Firmen ist das besonders relevant, da ambitionierte Klimaziele und der steigende Kostendruck durch den EU-Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ab 2026 enorme Herausforderungen mit sich bringen.
Die wichtigsten Punkte:
Fazit: Unternehmen müssen jetzt handeln, um Compliance-Probleme und Wettbewerbsnachteile zu vermeiden. Moderne Tools und klare Strategien helfen, Risiken zu minimieren und Chancen zu nutzen.
Nachdem wir die Herausforderungen skizziert haben, widmen wir uns nun den Ursachen und Risiken von Carbon Leakage, um ein genaueres Bild der Problematik zu zeichnen.
Ein wesentlicher Treiber von Carbon Leakage sind die unterschiedlichen Klimaregulierungen weltweit. Während die EU mit dem Emissionshandelssystem (EU ETS) vergleichsweise hohe Kohlenstoffpreise vorgibt, fallen diese in anderen Regionen kaum ins Gewicht. Diese Diskrepanz schafft Wettbewerbsverzerrungen, die Unternehmen dazu verleiten können, ihre Produktion in Länder mit niedrigeren oder gar keinen Kohlenstoffkosten zu verlagern.
Hinzu kommt die ungleiche globale Emissionsbepreisung, die den Druck auf Unternehmen weiter erhöht. Zwar ist der Anteil der weltweit abgedeckten Emissionen durch Kohlenstoffpreismechanismen von 0,7 % im Jahr 2003 auf 24 % im Jahr 2024 gestiegen, doch bleiben immer noch rund drei Viertel der globalen Emissionen unbepreist.
Auch die internationalen Handelsdynamiken tragen zum Problem bei. Unternehmen ziehen oft in Regionen mit weniger strikten Regulierungen, um von Kostenvorteilen zu profitieren. Laut einer Studie des Internationalen Währungsfonds liegt die durchschnittliche Carbon Leakage-Rate zwischen 13 % und 25 %. Das bedeutet: Wenn ein Land seine Emissionen um 100 Tonnen CO₂ reduziert, entstehen durch Produktionsverlagerungen in anderen Ländern zwischen 13 und 25 Tonnen zusätzliche Emissionen.
Diese Ursachen wirken sich nicht nur auf die globale Klimapolitik aus, sondern bergen auch erhebliche Risiken für Unternehmen.
Für Unternehmen ergeben sich aus Carbon Leakage mehrere Risiken, die sowohl finanzieller als auch strategischer Natur sind:
Die Folgen von Carbon Leakage gehen jedoch weit über die Unternehmensperspektive hinaus – sie stellen auch eine Herausforderung für die globalen Klimaziele dar.
Carbon Leakage untergräbt die Effektivität internationaler Klimaschutzmaßnahmen. So zeigt eine Analyse des EU-Emissionshandelssystems, dass Emissionsreduktionen innerhalb der EU teilweise durch steigende Emissionen in Nicht-EU-Ländern ausgeglichen wurden, weil Unternehmen ihre Produktion verlagerten.
Die unterschiedlichen Ansätze in der Klimapolitik weltweit verschärfen das Problem weiter. Während einige Regionen ambitionierte Klimaziele verfolgen, profitieren andere von der Ansiedlung emissionsintensiver Industrien. Dies führt zu einem Ungleichgewicht, das sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Fortschritte hemmt.
Ein weiteres Risiko besteht darin, dass der Eindruck von Fortschritt entsteht, obwohl die globalen Emissionen lediglich verlagert werden. Länder mit strengen Vorgaben können auf dem Papier Erfolge vorweisen, doch die tatsächliche Reduktion bleibt aus. Dies gefährdet letztlich die Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens.
Nicht zuletzt leidet auch die Glaubwürdigkeit der Klimapolitik. Wenn Bürger und Unternehmen die Wirksamkeit von Maßnahmen infrage stellen, sinkt die Akzeptanz für notwendige Veränderungen. Dies kann den gesellschaftlichen Konsens für Klimaschutz schwächen und die Umsetzung von Transformationsmaßnahmen erschweren.
Um Emissionsverlagerungen zu vermeiden, haben Regierungen verschiedene Instrumente entwickelt. Diese sollen nicht nur gleiche Wettbewerbsbedingungen schaffen, sondern auch die Umsetzung von Klimazielen unterstützen.
Der Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ist eines der zentralen Werkzeuge der EU, um Carbon Leakage einzudämmen. In der Übergangsphase sind Importeure verpflichtet, ihre Emissionsdaten offenzulegen, bevor finanzielle Anpassungen vorgenommen werden. Der Mechanismus richtet sich vor allem an energieintensive Branchen und verlangt den Erwerb von Zertifikaten zu marktbasierten Preisen. Für deutsche Unternehmen bedeutet das, dass sie die Emissionsintensität ihrer gesamten Lieferkette genauer erfassen müssen – insbesondere, wenn Zulieferer aus Ländern mit weniger strengen Klimavorgaben stammen.
Zusätzlich ergänzt die kostenlose Zuteilung von Zertifikaten den CBAM, um den Marktzugang für energieintensive Industrien abzusichern.
Neben dem CBAM setzt die EU weiterhin auf die kostenlose Zuteilung von Emissionszertifikaten, um energieintensive Branchen vor Wettbewerbsnachteilen zu bewahren. Unternehmen müssen dabei ihre Effizienz im Vergleich zu den modernsten Anlagen nachweisen. Mit der schrittweisen Einführung des CBAM wird jedoch der Anteil der kostenlos zugeteilten Zertifikate sukzessive reduziert. Für Unternehmen heißt das: Sie müssen ihre Strategien an die neuen Gegebenheiten anpassen, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.
Die beiden Ansätze – der CBAM und die kostenlose Zuteilung von Zertifikaten – verfolgen unterschiedliche Ziele. Während der CBAM durch die Einbeziehung von Importen klare Anreize zur Emissionsminderung setzt, bietet die kostenlose Zuteilung einen temporären Schutz für energieintensive Industrien. Eine kluge Kombination beider Instrumente kann dazu beitragen, ökologische und wirtschaftliche Ziele in Einklang zu bringen.
Gleichzeitig stehen diese Maßnahmen vor Herausforderungen, wie der internationalen Akzeptanz und der praktischen Umsetzung neuer Überwachungs- und Berichtssysteme. Dennoch bilden sie die Grundlage, auf der Unternehmen ihre Strategien gegen Emissionsverlagerungen aufbauen können.
Politische Maßnahmen wie der CBAM schaffen den regulatorischen Rahmen, doch Unternehmen müssen selbst aktiv werden, um Emissionsverlagerungen gezielt zu verhindern. Der erste Schritt ist die strategische Erfassung der Emissionsdaten, gefolgt von der Umsetzung internationaler Standards für eine umfassende Berichterstattung.
Automatisierte Plattformen zur CO₂-Analyse bieten Unternehmen eine schnelle und präzise Übersicht über ihre Emissionsrisiken. Tools wie MULTIPLYE ermöglichen es, die gesamte Emissionsbilanz eines Unternehmens effizient zu analysieren. Dabei liefern sie nicht nur eine geografische Darstellung der Geschäftsverbindungen, sondern erleichtern auch die Bewertung von Klimarisiken.
Durch KI-gestützte Analysen werden nicht nur aktuelle Emissionswerte ermittelt, sondern auch Einsparpotenziale aufgezeigt. Eine Heatmap der CO₂e-Bilanz zeigt auf einen Blick die größten Emissionsrisiken in der Lieferkette. Besonders für Unternehmen, die sich auf den CBAM vorbereiten, ist eine rückwirkende Analyse der vergangenen Jahre entscheidend, um Trends zu erkennen und Verlagerungsrisiken frühzeitig zu minimieren.
Zusätzlich sorgt eine lokal zertifizierte Datenhosting-Lösung dafür, dass strenge Datenschutz- und Compliance-Anforderungen eingehalten werden.
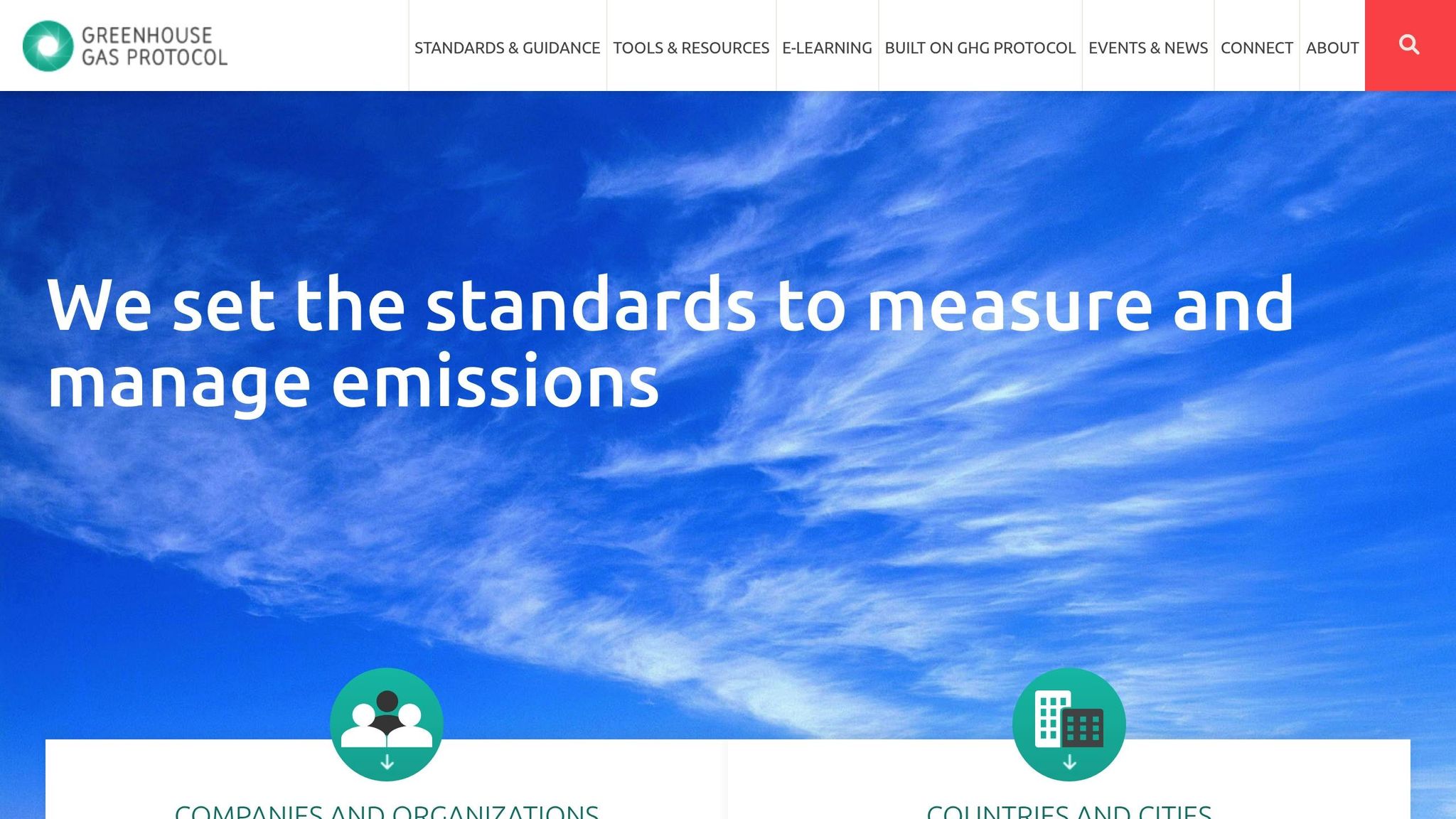
Die Anwendung internationaler Standards wie des GHG Protocol ist ein zentraler Baustein zur Vermeidung von Carbon Leakage. Dieses Protokoll ist weltweit anerkannt und bildet die Grundlage für eine präzise und transparente Emissionsberichterstattung. Der Einstieg erfolgt idealerweise mit dem Corporate Accounting and Reporting Standard, um den gesamten Inventarisierungsprozess besser zu verstehen.
Unternehmen sollten zunächst Aktivitätsdaten sammeln und einer Qualitätskontrolle unterziehen, bevor sie mit der Schätzung der Emissionen beginnen. Das GHG Protocol stellt dafür verschiedene Tools bereit, die auf unterschiedliche Branchen, Länder und Sektoren zugeschnitten sind. Beispiele hierfür sind:
Diese systematische Herangehensweise ermöglicht es, nicht nur direkte Emissionen zu erfassen, sondern auch die Emissionsintensität der gesamten Lieferkette transparent darzustellen.
Mit präzisen Daten und standardisierten Berichten können Unternehmen gezielte Maßnahmen zur Emissionsreduktion entwickeln. Diese Maßnahmen sind entscheidend, um die Verlagerung von Emissionen zu verhindern. Erfolgreiche Strategien stützen sich dabei auf drei zentrale Bereiche:
Diese Maßnahmen ergänzen den politischen Rahmen und helfen deutschen Unternehmen, ihre Position im globalen Markt langfristig zu sichern.
Deutsche Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Carbon Leakage-Risiken zu minimieren und gleichzeitig die strengen nationalen sowie europäischen Compliance-Vorgaben einzuhalten. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einer systematischen Herangehensweise, die technische und regulatorische Aspekte gleichermaßen berücksichtigt.
Ein erster Schritt ist die geografische Analyse eurer Lieferkette. Dabei sollten alle Zulieferer nach Ländern kategorisiert werden, insbesondere unter Berücksichtigung der jeweiligen CO₂-Bepreisung und regulatorischen Rahmenbedingungen. Besonders kritisch sind Partnerschaften mit Ländern, die keine verbindlichen Klimaziele verfolgen oder deutlich niedrigere CO₂-Preise haben.
Zusätzlich ist es wichtig, die Emissionsintensität verschiedener Produktionsstandorte zu untersuchen. Große Unterschiede können auf ein erhöhtes Risiko von Emissionsverlagerungen hindeuten. Gleichzeitig solltet ihr branchenspezifische Risiken sowie die Entwicklung der Energiepreise in euren Produktionsregionen im Blick behalten, da erhebliche Preisunterschiede Verlagerungsanreize schaffen können.
Automatisierte Tools wie MULTIPLYE können dabei helfen, Veränderungen in der Emissionsbilanz frühzeitig zu erkennen. Während ihr diese Risiken identifiziert, ist es entscheidend, alle erhobenen Daten DSGVO-konform zu schützen, um die Privatsphäre und die Sicherheit eurer Geschäftspartner zu gewährleisten.
Die Einhaltung der Datenschutzstandards ist bei der CO₂-Bilanzierung ein Muss. Die DSGVO schreibt vor, dass Emissionsdaten, die Rückschlüsse auf Geschäftspartner oder interne Prozesse zulassen, besonders geschützt werden müssen. Lokale Datenhosting-Lösungen in Deutschland bieten hier oft eine sichere Option.
Sämtliche Berechnungsmethoden, Emissionsfaktoren und Datenquellen sollten lückenlos dokumentiert werden, um externe Prüfungen zu erleichtern. Wichtig ist auch die Nachverfolgbarkeit von Änderungen in der Datenerfassung über längere Zeiträume.
Die Integration in bestehende ERP-Systeme sollte über sichere API-Schnittstellen erfolgen, um eine automatisierte und fehlerfreie Datenübertragung zu gewährleisten. Gleichzeitig müssen Zugriffsrechte granular verwaltet und regelmäßig überprüft werden, um unbefugte Zugriffe zu verhindern.
Ein weiterer Punkt ist die Berichterstattung nach den Vorgaben der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Ab 2024 sind große Unternehmen verpflichtet, detaillierte Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen, die auch Carbon Leakage-Risiken und Gegenmaßnahmen umfassen. Diese Berichte sollten auf einer präzisen Risikobewertung basieren und klar darlegen, wie die Maßnahmen mit den deutschen Klimazielen in Einklang stehen.
Um die deutschen Klimaziele zu erreichen, müssen Unternehmen sektorspezifische Maßnahmen ergreifen. Das Klimaschutzgesetz sieht vor, die Treibhausgasemissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990 deutlich zu reduzieren. Setzt euch ambitionierte interne Ziele und entwickelt klare Strategien, um diese zu erreichen.
Technologische Roadmaps und Förderprogramme wie die Bundesförderung für Energieeffizienz in der Wirtschaft (BfEE) oder das Umweltinnovationsprogramm bieten finanzielle Unterstützung für Investitionen in klimafreundliche Technologien. Die Zusammenarbeit mit deutschen Forschungseinrichtungen wie dem Fraunhofer ISI oder dem Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie kann ebenfalls wertvolle Impulse liefern.
Branchenallianzen und Industrieinitiativen sind eine weitere Möglichkeit, um gemeinsam Standards zu setzen und Best Practices auszutauschen. So hat die Stahlindustrie mit der Initiative „Steel Zero“ Dekarbonisierungspfade definiert, die auch anderen Branchen als Vorbild dienen können.
Ein oft unterschätzter Hebel sind Vergütungssysteme des Managements. Unternehmen, die CO₂-Reduktionsziele als messbare KPIs in ihre Bonussysteme integrieren, erzielen häufig bessere Ergebnisse bei der Emissionsreduktion. Gleichzeitig wird das Risiko von Verlagerungseffekten reduziert. Diese Maßnahmen greifen optimal ineinander und schaffen eine solide Grundlage, um Carbon Leakage effektiv zu verhindern.
Carbon Leakage ist für deutsche Unternehmen längst keine abstrakte Gefahr mehr, sondern Realität. Der Energiepreisschock, ausgelöst durch Russlands Einmarsch in die Ukraine 2022, hat dazu geführt, dass energieintensive Produktionen ins Ausland abwandern – ein Trend, der angesichts anhaltend hoher Energiepreise weiterbesteht.
Die Herausforderungen sind deutlich: Etwa drei Viertel der deutschen Unternehmen können derzeit keine vollständigen Emissionsdaten ihrer Zulieferer außerhalb der EU für das CBAM bereitstellen. Mit dem Ende der Übergangsphase des Carbon Border Adjustment Mechanism steigt der Druck auf Unternehmen, zuverlässige Überwachungs- und Berichtssysteme einzuführen. Wer jetzt zögert, riskiert nicht nur Compliance-Probleme, sondern auch einen spürbaren Wettbewerbsnachteil.
Dabei ist der Kontrast zu Deutschlands bisherigen Erfolgen im Klimaschutz frappierend. Zwischen 1990 und 2020 konnte Deutschland seine CO₂-Emissionen um rund 35 Prozent senken – sowohl auf Produktions- als auch Konsumbasis – und das weitgehend ohne nennenswerte Emissionsverlagerungen bis zur jüngsten Energiekrise. Diese Leistungen beweisen, dass Klimaschutz ohne Carbon Leakage möglich ist, wenn die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt werden.
Passivität ist keine Option mehr. Unternehmen, die Carbon Leakage aktiv angehen, haben die Chance, ihre Lieferketten neu auszurichten, die Transparenz ihrer Daten zu steigern und das CBAM als strategischen Vorteil zu nutzen, statt es als Belastung zu sehen. Moderne Carbon Accounting Tools ermöglichen es, Emissionsdaten effizient zu erfassen und auszuwerten. Sie leisten nicht nur einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele Deutschlands und der EU, sondern erhöhen auch die Kosteneffizienz der Klimapolitik.
Die Zeit zu handeln ist jetzt. Analysiert eure Lieferketten, implementiert DSGVO-konforme Carbon Accounting-Systeme und nutzt verfügbare Förderprogramme sowie Brancheninitiativen. Nur wer proaktiv handelt, kann die Herausforderungen der kommenden Jahre in Chancen umwandeln – und dabei einen echten Unterschied im globalen Klimaschutz machen.
Moderne Carbon-Accounting-Tools geben euch die Möglichkeit, eure CO₂-Emissionen präzise zu messen und im Blick zu behalten. Das ist besonders wichtig, um Carbon Leakage – also die Verlagerung von Emissionen in Länder mit weniger strengen Klimavorgaben – zu verhindern.
Diese Werkzeuge erlauben es, Emissionsquellen sowohl entlang der gesamten Lieferkette als auch innerhalb des eigenen Betriebs detailliert zu analysieren. So könnt ihr gezielt Maßnahmen ergreifen, um Emissionen dort zu verringern, wo sie tatsächlich entstehen. Gleichzeitig sorgt die transparente Dokumentation der Daten dafür, dass ihr gesetzliche Vorgaben leichter einhaltet und Vertrauen bei euren Stakeholdern aufbaut.
Durch die systematische Auswertung der Daten lassen sich Klimastrategien gezielt verbessern, Risiken minimieren und eure Position in einem Markt stärken, der immer mehr auf Nachhaltigkeit setzt. Mit diesen Tools wird es einfacher, Emissionen zu senken, ohne dabei wirtschaftliche Nachteile in Kauf nehmen zu müssen.
Der EU-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) ist ein Werkzeug, das entwickelt wurde, um Carbon Leakage zu vermeiden und gleiche Wettbewerbsbedingungen sicherzustellen. Dabei wird eine CO₂-Abgabe auf Importe aus Ländern erhoben, die weniger strenge Klimaschutzvorgaben haben. Ziel ist es, Unternehmen in der EU vor Konkurrenz durch günstigere, aber emissionsintensive Produkte aus dem Ausland zu schützen.
Wie könnt ihr euch auf den CBAM vorbereiten? Hier ein paar zentrale Ansätze:
Diese Schritte helfen nicht nur dabei, mögliche Zusatzkosten durch den CBAM zu reduzieren, sondern stärken auch eure Position im Markt und tragen zu einer nachhaltigeren Unternehmensstrategie bei.
Unternehmen können ein internes CO2-Bepreisungssystem einführen, um Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu erfassen und gezielt Anreize für emissionsarme Technologien zu schaffen. Damit lassen sich nachhaltige Prozesse vorantreiben und das Risiko von Emissionsverlagerungen minimieren.
Ein weiterer wichtiger Hebel ist die Optimierung der Lieferketten. Durch die Zusammenarbeit mit regionalen und umweltfreundlichen Zulieferern sowie den Einsatz emissionsarmer Transportmethoden können Unternehmen ihren ökologischen Fußabdruck spürbar reduzieren. Gleichzeitig bieten Investitionen in emissionsarme Produktionsverfahren die Möglichkeit, wettbewerbsfähig zu bleiben, ohne in Länder mit geringeren Klimaschutzauflagen ausweichen zu müssen.
Solche Maßnahmen tragen nicht nur dazu bei, die eigenen Klimaziele zu erreichen, sondern stärken auch die langfristige Wettbewerbsfähigkeit und das Ansehen eines Unternehmens.