Melde dich jetzt für die Warteliste an.
Für Warteliste anmelden
Für Warteliste anmelden

Die Integration von CO₂-Accounting in ERP-Systeme ist für Unternehmen in der EU seit 2025 unverzichtbar. Mit der Einführung der CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) sind nun etwa 15.000 Unternehmen in Deutschland und 50.000 in der EU verpflichtet, ihre Emissionen präzise zu erfassen und zu berichten. Manuelle Prozesse stoßen dabei schnell an ihre Grenzen – effiziente ERP-Lösungen schaffen Abhilfe.
Was ihr wissen müsst:
Euer Vorteil: Mit der richtigen ERP-Integration spart ihr Zeit, reduziert Fehler und erfüllt die gesetzlichen Anforderungen effizient.
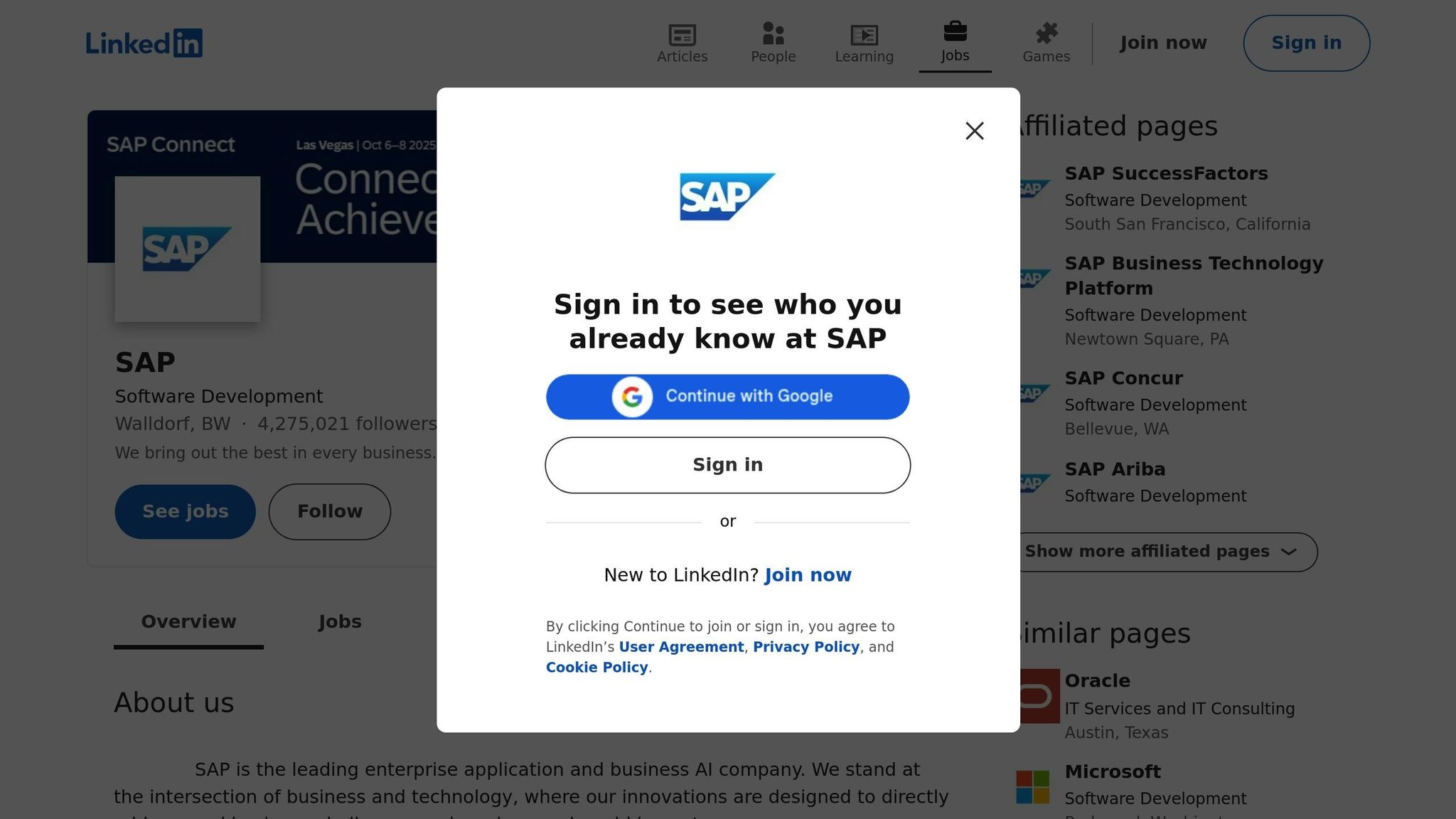
Die Einbindung von CO₂-Bilanzierung in bestehende ERP-Systeme ist kein einfacher Prozess. Sie bringt technische, regulatorische und organisatorische Hürden mit sich, die den Fortschritt oft verlangsamen. Besonders die Themen Datenformate, Datenqualität, gesetzliche Vorgaben und technische Einschränkungen spielen dabei eine zentrale Rolle.
Eine der größten Herausforderungen liegt in der Vielzahl an Datenformaten und dem Fehlen einheitlicher Standards. ERP-Systeme müssen Informationen aus unterschiedlichsten Quellen wie Produktionsanlagen, Energiemesssystemen und Lieferantendaten zusammenführen – oft sind diese Daten in verschiedenen Formaten und Einheiten verfügbar.
„Wenn Unternehmen das ERP-System mit einem MES und einem System zur Maschinen- und Anlagendatenerfassung kombinieren, haben sie bereits heute Zugang zu etwa 70 Prozent der für das GHG-Protokoll erforderlichen Daten. Scope-1-Daten können fast vollständig erfasst werden. Generell sind die meisten relevanten Daten im ERP- und MES-System gespeichert." – Lucas Leinweber, Teamleiter CO₂-Management bei ENIT
Die automatisierte Erfassung dieser Daten über ERP-Systeme und IoT-Sensoren ist ein entscheidender Schritt, um CO₂-Berechnungen effizient zu gestalten. Unternehmen sollten auf offene Schnittstellen setzen, die mit verschiedenster Hardware kompatibel sind. ERP-Systeme spielen dabei eine zentrale Rolle, da sie Daten aus wichtigen Bereichen wie Auftragsverwaltung, Beschaffung und Produktion bündeln.
Neben den Formatfragen ist die Qualität der Daten ein kritischer Faktor. Für eine verlässliche CO₂-Bilanzierung sind präzise und vollständige Daten unverzichtbar. Doch viele Organisationen kämpfen mit Problemen wie Inkonsistenzen, fehlender Automatisierung bei der Erfassung von Nachhaltigkeitsdaten und der Komplexität von Emissionsberechnungen. Eine Untersuchung von Emissionsberichten aus der Öl- und Gasbranche zeigte, dass rund 38,9 % der Unternehmen grundlegende Konsistenzprüfungen nicht bestanden.
Zu den zentralen Qualitätsmerkmalen von ERP-Daten gehören Genauigkeit, Vollständigkeit, Konsistenz, Relevanz und Aktualität. Häufige Probleme sind doppelte, unvollständige oder veraltete Daten sowie uneinheitliche Formate. Solche Schwachstellen können die CO₂-Bilanzierung erheblich beeinträchtigen.
Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen. Sie erweitert die Anzahl der berichtspflichtigen Unternehmen von etwa 11.600 auf 50.000 und verlangt die Dokumentation von über 1.100 Datenpunkten gemäß den European Sustainability Reporting Standards (ESRS). In Deutschland betrifft dies etwa 14.000 Unternehmen. Neben detaillierten ESG-Angaben müssen auch die Scope-1-, 2- und 3-Emissionen offengelegt werden.
Die Berichterstattung nach CSRD muss prüfungssicher und in einem standardisierten digitalen Format erfolgen. Gleichzeitig werden klare Emissionsreduktionsziele, eine transparente Klimastrategie sowie Maßnahmen zur Risikominderung erwartet.
„Jedes Unternehmen und jede Branche wird durch den Übergang zu einer Netto-Null-Welt transformiert werden. Die Frage ist: Werden Sie führen oder geführt werden?" – Laurence D. Fink
Viele ältere ERP-Systeme, sogenannte Legacy-Systeme, sind nicht auf die komplexen Anforderungen der CO₂-Bilanzierung ausgelegt. Zwar bieten sie eine zentrale Datenquelle, doch die Integration ist oft kompliziert und fehleranfällig. Die Prozesse reichen von der Datensammlung über die Bereinigung und Deduplizierung bis hin zur abschließenden Bewertung.
Häufige Schwierigkeiten bei der Datenmigration sind kleine Fehler, die große Auswirkungen haben können, mangelnde Datenqualität und Probleme bei der Stammdatenerfassung. Schlechte Datenqualität führt oft zu ungenauen Berichten, ineffizienten Prozessen und erhöhtem Aufwand. Die International Data Corporation (IDC) schätzt, dass bis 2024 fast 75 % der großen Unternehmen Software für ESG-Datenmanagement und -Berichte einsetzen werden.
Um die Herausforderungen effizient zu meistern, stellen wir euch hier konkrete technische Ansätze vor, die sowohl die Datenqualität als auch die Prozess-Effizienz verbessern.
APIs (Application Programming Interfaces) sind das Rückgrat moderner ERP-Integrationen. Sie ermöglichen den fließenden Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Systemen und schaffen die Basis für eine automatisierte CO₂-Bilanzierung. Besonders REST-APIs sind vielseitig, plattformunabhängig und unterstützen Standardformate wie JSON und XML.
Bei der Implementierung solltet ihr auf offene Schnittstellen achten, die mit verschiedenen Hardwaretypen kompatibel sind. So können IoT-Sensoren, Produktionsanlagen oder externe Datenquellen wie Energieversorger und Lieferanten problemlos angebunden werden. Eine bidirektionale API sorgt dafür, dass Daten und Rückmeldungen effizient zwischen den Systemen fließen.
Echtzeitfähige APIs spielen eine zentrale Rolle, da sie eine kontinuierliche Überwachung der CO₂-Emissionen ermöglichen. Webhook-Mechanismen stellen sicher, dass Änderungen in einem System sofort an alle verbundenen Systeme weitergeleitet werden. Das schafft Transparenz und schnelle Reaktionsmöglichkeiten.
Der automatisierte Import von Daten reduziert Fehler und sorgt durch strenge Eingabestandards für konsistente Datensätze. Eine Echtzeit-Validierung gibt sofort Rückmeldung, falls Eingabefehler auftreten, und verhindert fehlerhafte Übertragungen.
| Feldname | Validierungsregel | Fehlermeldung |
|---|---|---|
| Energieverbrauch | Positive Dezimalzahl, max. 2 Nachkommastellen | Energieverbrauch muss positiv sein |
| Emissionsfaktor | Numerisch, Bereich 0,1–10,0 | Emissionsfaktor außerhalb des Bereichs |
| Standort-ID | Alphanumerisch, 8 Zeichen | Standort-ID muss 8 Zeichen haben |
Ein mehrstufiger Validierungsansatz unterscheidet zwischen kritischen und weniger kritischen Daten, sodass die Prüfung gezielt dort intensiviert wird, wo höchste Genauigkeit erforderlich ist. Audit-Trails dokumentieren alle Datenänderungen und ermöglichen es, Fehlerquellen schnell zu identifizieren.
Eine reibungslose CO₂-Bilanzierung erfordert, dass eure Organisationsstrukturen optimal aufeinander abgestimmt sind. ERP-Systeme spielen dabei eine Schlüsselrolle, da sie verschiedene Prozesse im HSE-Management (Health, Safety, and Environment) integrieren und eine zentrale Plattform für Datenmanagement, Ressourcenzuteilung und Entscheidungsfindung bieten.
„ERP ist 'ein integriertes Informationssystem, das zur Verwaltung aller Ressourcen, Daten und Funktionen eines Unternehmens aus gemeinsamen Datenspeichern verwendet werden kann'."
Die Einführung von Umweltmodulen in ERP-Systemen hilft dabei, Verantwortlichkeiten klar zu definieren und Prozesse effizienter zu gestalten. Dazu gehört auch, Kostenstellen und Verantwortlichkeiten zwischen ERP-System und CO₂-Bilanzierung sorgfältig abzustimmen.
Künstliche Intelligenz (KI) bringt mit Machine Learning neue Möglichkeiten, Muster in Emissionsdaten zu erkennen und so proaktiv Optimierungen vorzunehmen. Mithilfe von Predictive Analytics lassen sich künftige Emissionstrends vorhersagen, sodass ihr frühzeitig Gegenmaßnahmen planen könnt.
KI-gestützte Systeme identifizieren automatisch Anomalien in den Emissionsdaten und lösen Alarme aus, wenn festgelegte Schwellenwerte überschritten werden. Das reduziert den manuellen Aufwand, vor allem bei komplexen Berechnungen wie denen im Scope-3-Bereich, und erhöht zugleich die Genauigkeit.
Der Schutz sensibler Emissionsdaten ist entscheidend, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der DSGVO. End-to-End-Verschlüsselung sorgt dafür, dass Daten sowohl bei der Übertragung als auch bei der Speicherung geschützt bleiben.
Strenge Zugriffskontrollen stellen sicher, dass nur autorisierte Personen auf bestimmte Daten zugreifen können. Darüber hinaus schützen Maßnahmen wie Datenminimierung, Anonymisierung und Pseudonymisierung personenbezogene Informationen, während aussagekräftige Analysen weiterhin möglich sind. So bleibt die Balance zwischen Datenschutz und Datenqualität gewahrt.
Die technische Integration allein reicht nicht aus – sie muss durch eine enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen ergänzt werden. Der Erfolg hängt maßgeblich davon ab, wie gut IT, Nachhaltigkeit und Fachbereiche miteinander agieren und wie strukturiert der Wandel organisiert wird. Diese Kooperation bildet die Grundlage für gezielte Schulungsprogramme und ein funktionierendes Feedback-System.
Eine frühzeitige Abstimmung zwischen den beteiligten Abteilungen kann technische und organisatorische Reibungsverluste deutlich reduzieren. Die IT-Abteilung bringt das technische Know-how ein, Nachhaltigkeitsmanager kennen die fachlichen Anforderungen, und Entscheidungsträger aus den Fachbereichen haben den besten Überblick über die operativen Abläufe.
Ein gemeinsames Projektteam mit festen Ansprechpartnern aus IT, Nachhaltigkeit und den Fachbereichen sorgt für einen reibungslosen Informationsfluss. So können die IT-Teams frühzeitig auf technische Einschränkungen hinweisen, während die Nachhaltigkeitsexperten sicherstellen, dass alle regulatorischen Vorgaben, wie etwa die Anforderungen der CSRD, eingehalten werden. Die Fachbereiche wiederum tragen dazu bei, dass die Lösungen praxistauglich bleiben und die Arbeitsprozesse effizient gestaltet sind.
Klare Rollenverteilungen und direkte Kommunikationswege innerhalb des Projektteams helfen, Missverständnisse und Verzögerungen zu vermeiden. Diese festen Ansprechpartner übernehmen auch die interne Kommunikation und stellen sicher, dass keine wichtigen Informationen verloren gehen.
Damit Mitarbeitende die neuen Prozesse erfolgreich umsetzen können, benötigen sie passende Schulungen und Unterstützung. Praxisorientierte Trainings und maßgeschneiderte Hilfestellungen bereiten sie optimal auf die neuen Anforderungen vor.
Ein Beispiel hierfür ist das GLEC Framework e-Training des Smart Freight Centre (SFC). Es vermittelt die Grundlagen zur Berechnung und Berichterstattung von CO₂-Emissionen in der globalen Lieferkette. Ergänzend dazu bietet der GLEC & ISO 14083 Calculation Workshop praktische Einblicke in die Anwendung des GLEC Frameworks und die Emissionsberechnung nach ISO 14083.
Die Schulungsinhalte sollten auf die unterschiedlichen Zielgruppen abgestimmt sein: IT-Teams benötigen Wissen über technische Themen wie API-Schnittstellen und Datenvalidierung, während Nachhaltigkeitsexperten tiefere Einblicke in Emissionsfaktoren und Berechnungsmethoden brauchen. Mitarbeitende aus den Fachbereichen wiederum profitieren von einer leicht verständlichen Einführung in die neuen Arbeitsabläufe.
Plan A bietet hierzu persönliche Unterstützung durch Kohlenstoffbuchhalter, Politikexperten und Kundenbetreuer sowie Zugang zu spezifischen Ressourcen, Veranstaltungen und Networking-Möglichkeiten. Das Unternehmen betont:
„Grow your expertise through digital or personal learning opportunities."
Ein gut funktionierendes Feedback-System ist entscheidend, um Probleme frühzeitig zu erkennen und Lösungen zu entwickeln. Regelmäßige Feedback-Zyklen, unterstützt durch digitale Tools, ermöglichen eine kontinuierliche Optimierung der Prozesse und fördern die Akzeptanz.
Das Feedback sollte systematisch ausgewertet werden, wobei sowohl technische Herausforderungen als auch Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsabläufe berücksichtigt werden. Ein regelmäßiger Austausch zwischen IT, Nachhaltigkeit und Fachbereichen stellt sicher, dass alle Perspektiven einbezogen werden.
Performance-Monitoring ergänzt das qualitative Feedback um messbare Daten. Kennzahlen wie die Anzahl der Datenfehler, die Bearbeitungszeit für Berichte oder die Nutzungsrate neuer Funktionen liefern wertvolle Hinweise darauf, wo noch Verbesserungsbedarf besteht.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Transparenz im Verbesserungsprozess. Mitarbeitende sollten nachvollziehen können, wie ihre Rückmeldungen zu konkreten Veränderungen führen. Das stärkt die Motivation, sich aktiv einzubringen und die neuen Prozesse weiterzuentwickeln.
Dieser fortlaufende Verbesserungsprozess sorgt dafür, dass das CO₂-Accounting langfristig und erfolgreich im Unternehmen verankert wird.
Die Integration von CO₂-Accounting in ERP-Systeme bringt nicht nur technische und organisatorische Vorteile, sondern automatisiert auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Gleichzeitig ermöglicht sie zuverlässige Compliance- und Monitoring-Funktionen. So können Unternehmen regulatorische Vorgaben erfüllen und strategische Entscheidungen auf einer fundierten Datenbasis treffen.
Ab 2024/2025 verpflichtet die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) immer mehr Unternehmen in Deutschland und Europa, detaillierte Berichte zur Nachhaltigkeit zu erstellen. Hier kommen integrierte ERP-Systeme ins Spiel: Sie bieten vorkonfigurierte Templates für CSRD-konforme Berichte und automatisieren die Erfassung der Emissionsdaten für Scope 1, 2 und 3.
Die Systeme greifen direkt auf die Emissionsdaten aus den Geschäftsprozessen zu und übertragen sie automatisch in das benötigte Berichtsformat, beispielsweise das XBRL-Format. Dadurch wird der manuelle Aufwand erheblich reduziert, und die fristgerechte Einreichung der Berichte ist sichergestellt.
Ein weiterer Vorteil ist die automatische Aktualisierung der Emissionsfaktoren aus anerkannten Datenbanken. Da sich diese Faktoren regelmäßig ändern, wäre eine manuelle Pflege nicht nur zeitaufwendig, sondern auch fehleranfällig. Diese automatisierten Prozesse schaffen die Grundlage für eine Echtzeitüberwachung, mit der Unternehmen ihre Emissionsdaten kontinuierlich im Blick behalten können.
Mit Live-Analytics und Visualisierungen können Führungskräfte den Fortschritt bei Nachhaltigkeitszielen in Echtzeit verfolgen. Diese Dashboards lassen sich flexibel an die Anforderungen deutscher und europäischer Vorschriften anpassen.
Die Dashboards stellen wichtige KPIs übersichtlich dar und lösen automatisierte Warnmeldungen aus, wenn Schwellenwerte überschritten oder ungewöhnliche Emissionsmuster erkannt werden. Zudem bieten Trendanalysen wertvolle Einblicke, um frühzeitig Verbesserungspotenziale zu erkennen und gezielte Maßnahmen zur Senkung von Emissionen zu ergreifen.
Die verständliche Darstellung komplexer Emissionsdaten in Grafiken erleichtert es der Geschäftsleitung, auch ohne tiefgehendes technisches Wissen fundierte Entscheidungen zu treffen.
Eine vollständige und automatisierte Dokumentation aller Emissionsdaten ist unerlässlich, um gegenüber Behörden und Stakeholdern Rechenschaft abzulegen. Integrierte ERP-Systeme erstellen Audit-Trails, die sowohl interne als auch externe Prüfungen unterstützen.
Zu den praktischen Funktionen zählen die automatische Protokollierung von Datenquellen und Änderungen, eine Versionskontrolle für Emissionsberechnungen sowie die sichere Speicherung von Belegen. Die Versionskontrolle ermöglicht es, Änderungen an Berechnungsmethoden oder Emissionsfaktoren transparent nachzuvollziehen.
Darüber hinaus sorgen sichere Datenspeicherung und Zugangskontrollen dafür, dass sensible Emissionsdaten geschützt sind und die Anforderungen der DSGVO erfüllt werden. Diese kontinuierliche Überwachung hilft Unternehmen, ihre Emissionen besser zu managen und ihre Strategien flexibel anzupassen.
Die Integration von CO₂-Accounting in bestehende ERP-Systeme ist weit mehr als nur eine technische Aufgabe – sie verändert die gesamte Arbeitsweise eines Unternehmens. Wer diese Integration erfolgreich umsetzt, schafft die Basis für eine präzise und kontinuierliche Erfassung von Emissionsdaten in den Bereichen Scope 1, 2 und 3.
Der Erfolg hängt dabei stark von der Verknüpfung von Technologie, Strategie und Zusammenarbeit ab. Automatisierte Datenimporte und API-Schnittstellen können ihr volles Potenzial nur dann entfalten, wenn sie mit einer klar definierten Nachhaltigkeitsstrategie und einer bereichsübergreifenden Zusammenarbeit einhergehen. Dieser umfassende Ansatz minimiert Fehlerquellen, verbessert die Datenqualität und macht das CO₂-Accounting zu einem festen Bestandteil der täglichen Geschäftsabläufe.
Durch die Nutzung bestehender Daten und die Integration externer Emissionsfaktoren können Unternehmen ihre Datenverfügbarkeit erheblich steigern. So ist es beispielsweise möglich, die Verfügbarkeit von Scope-1-Daten in bestimmten Prozessen auf bis zu 83 % zu erhöhen. Eine solche Optimierung erfordert jedoch auch eine systematische Anpassung der Unternehmensstrukturen.
Die langfristige Verankerung von CO₂-Accounting in der Unternehmenskultur gelingt nur, wenn regelmäßige Workshops, gemeinsame KPIs und klare Kommunikationswege etabliert werden. Diese Maßnahmen fördern die bereichsübergreifende Zusammenarbeit und schaffen ein gemeinsames Verständnis für Nachhaltigkeitsziele.
Mit der Kombination aus technischer Integration und strategischer Ausrichtung eröffnet sich für Unternehmen die Chance, Nachhaltigkeit fest in ihre Geschäftsprozesse zu integrieren. Gleichzeitig leisten sie einen messbaren Beitrag zu den globalen Klimazielen. KI-gestützte Tools ermöglichen zudem Echtzeitanalysen und die Identifikation von Verbesserungspotenzialen – ein klarer Vorteil in einer Geschäftswelt, die zunehmend auf Nachhaltigkeit setzt.
Um den Vorgaben der CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) gerecht zu werden, ist es entscheidend, eure ERP-Systeme um Funktionen für das CO₂-Accounting zu erweitern. Dies umfasst die Erfassung, Verarbeitung und Berichterstattung von Emissionsdaten gemäß den European Sustainability Reporting Standards (ESRS).
Eine enge Zusammenarbeit zwischen IT-, Nachhaltigkeits- und Fachabteilungen ist unerlässlich, um langfristig sowohl die Datenqualität als auch die Einhaltung der Compliance-Vorgaben sicherzustellen. So bleibt ihr nicht nur gesetzeskonform, sondern schafft auch eine solide Basis für nachhaltige Geschäftsprozesse.
APIs spielen eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, Daten im CO₂-Accounting effizient und präzise zu verwalten. Sie sorgen für eine automatisierte und zuverlässige Datenübertragung zwischen verschiedenen Systemen. Das reduziert nicht nur manuelle Eingabefehler, sondern erleichtert auch die Synchronisation komplexer Unternehmensstrukturen. Das Ergebnis? Eine schnellere und konsistentere Erfassung von Emissionsdaten, die den Arbeitsaufwand deutlich verringert.
KI-gestützte Tools gehen noch einen Schritt weiter: Sie analysieren große Datenmengen in kürzester Zeit, liefern präzise Echtzeitprognosen zu Emissionen und helfen bei der Bewertung von ESG-Kriterien. Durch ihre Fähigkeit, Fehlerquellen zu minimieren und Prozesse zu beschleunigen, tragen sie erheblich zur Genauigkeit und Effizienz bei.
Zusammen sorgen APIs und KI-Technologien dafür, dass die Datenintegrität gewahrt bleibt und CO₂-Bilanzen nahtlos in eure Geschäftsprozesse integriert werden können. So wird nicht nur die Qualität der Daten verbessert, sondern auch die Grundlage für fundierte Entscheidungen geschaffen.
Um euer Team optimal auf die neuen CO₂-Bilanzierungsprozesse vorzubereiten, ist es sinnvoll, gezielte Schulungen und Workshops anzubieten. Diese Maßnahmen fördern nicht nur das Verständnis für die neuen Abläufe, sondern stärken auch die Akzeptanz und das Engagement. Dabei spielt eine offene und klare Kommunikation eine zentrale Rolle: Wenn alle über die Ziele, die Vorteile und ihre individuellen Aufgaben im Prozess informiert sind, entsteht Vertrauen und Motivation.
Ebenso wichtig ist es, Verantwortlichkeiten und Abläufe präzise festzulegen. Kombiniert mit durchdachten Change-Management-Strategien lassen sich Unsicherheiten reduzieren und ein reibungsloser Übergang sicherstellen. Eine enge Zusammenarbeit zwischen IT, Nachhaltigkeit und den Fachbereichen ist dabei entscheidend. Sie sorgt dafür, dass die neuen Prozesse nicht nur eingeführt, sondern dauerhaft erfolgreich umgesetzt werden können.