Melde dich jetzt für die Warteliste an.
Für Warteliste anmelden
Für Warteliste anmelden
Scope-3-Emissionen – eine Herausforderung für KMU, die sich lohnt anzugehen. Warum? Weil sie im Durchschnitt 92 % der gesamten Emissionen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ausmachen. Besonders drei Kategorien sind dabei relevant: eingekaufte Güter und Dienstleistungen, Transport und Logistik sowie Geschäftsreisen und Pendlerverkehr. Hier könnt ihr mit überschaubarem Aufwand starten, eure Daten erfassen und Emissionen senken.
Mit einem stufenweisen Ansatz und den richtigen Tools könnt ihr eure Scope-3-Emissionen effizient angehen – und gleichzeitig eure Lieferkette transparenter machen.
Das GHG Protocol definiert insgesamt 15 Kategorien für Scope-3-Emissionen, doch für KMU stehen in der Regel drei Bereiche im Fokus. Diese machen den Großteil der Emissionen aus und bieten zugleich gute Möglichkeiten, sie zu verringern – oft mit überschaubarem Aufwand bei der Datenerfassung. Diese Schwerpunkte bilden die Grundlage für die detaillierte Datenerhebung, die im nächsten Abschnitt besprochen wird.
Emissionen aus extern bezogenen Produkten und Dienstleistungen können durch gezielte Dokumentation erfasst werden. Dabei solltet ihr sowohl das Einkaufsvolumen (z. B. in Kilogramm, Litern oder Stückzahlen) als auch die Ausgaben in Euro festhalten. Es ist sinnvoll, Hauptkategorien wie Rohstoffe, Verpackungen, IT-Ausrüstung oder externe Dienstleistungen zu definieren.
Ein zentraler Schritt ist die Berücksichtigung der Emissionsfaktoren eurer Lieferanten, um den CO₂-Ausstoß pro Produkteinheit zu berechnen. Größere Lieferanten stellen oft eigene Emissionsdaten bereit. Für kleinere Partner können hingegen Durchschnittswerte aus Datenbanken herangezogen werden.
Um mit euren Ressourcen möglichst effektiv zu arbeiten, empfiehlt sich das Pareto-Prinzip: Identifiziert die wichtigsten Lieferanten, die den Großteil der Emissionen verursachen. So könnt ihr die relevantesten Daten erfassen und gezielt Maßnahmen zur Reduktion umsetzen.
Transport und Logistik – sowohl im Wareneingang als auch beim Versand – sind eine weitere bedeutende Scope-3-Kategorie. Besonders exportorientierte Unternehmen müssen hier oft mit erheblichen Emissionen rechnen, die durch verschiedene Transportarten entstehen.
Für eine präzise Erfassung solltet ihr Daten zu den zurückgelegten Strecken, den eingesetzten Verkehrsmitteln (z. B. LKW, Bahn, Schiff, Flugzeug) und dem transportierten Gewicht von euren Logistikpartnern einholen. Die Emissionsintensität variiert je nach Transportmittel: Während Luftfracht und LKW oft höhere Emissionen verursachen, sind Schienenverkehr und Seefracht meist weniger belastend.
Ein strukturierter Überblick über die zentralen Transportwege, aufgeschlüsselt nach Verkehrsmitteln, erleichtert die Analyse spürbar. Viele Logistikdienstleister bieten mittlerweile detaillierte Emissionsberichte an, die euch bei der Datensammlung unterstützen können. Mit diesen Informationen könnt ihr gezielt Maßnahmen zur Emissionsminderung entwickeln.
Auch Geschäftsreisen und der tägliche Pendelverkehr eurer Mitarbeitenden zählen zu den wichtigen Scope-3-Kategorien. Hier ist eine Unterscheidung zwischen dienstlichen Reisen und dem Arbeitsweg entscheidend.
Für Geschäftsreisen solltet ihr Daten zu den genutzten Verkehrsmitteln, den zurückgelegten Distanzen und der Anzahl der Reisenden erfassen. Verschiedene Transportarten haben dabei unterschiedliche Auswirkungen auf die Emissionen: Flüge verursachen in der Regel deutlich mehr CO₂ als Bahnreisen.
Beim Pendlerverkehr, den ihr als Unternehmen nicht direkt steuern könnt, bieten sich regelmäßige Mitarbeiterbefragungen an. Dabei solltet ihr Informationen zu den genutzten Verkehrsmitteln, den täglichen Pendelstrecken und der Verteilung von Büro- und Homeoffice-Tagen erheben. In Deutschland profitieren viele Unternehmen von der guten Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, und flexible Homeoffice-Regelungen können zusätzlich zur Reduktion der Emissionen beitragen.
Solche Befragungen helfen euch, verlässliche Daten für die Scope-3-Berichterstattung zu generieren. Dabei lohnt es sich, auch saisonale Unterschiede zu berücksichtigen. Mit diesen Daten könnt ihr gezielt Maßnahmen zur Emissionsreduktion planen und umsetzen.
Die Erfassung von Lieferkettendaten ist der Grundstein für eine fundierte Scope-3-Bilanzierung. Doch welche Informationen werden benötigt, welche Hindernisse tauchen auf, und wie lassen sich diese bewältigen? Hier werfen wir einen genaueren Blick auf die entscheidenden Daten und Ansätze.
Um präzise Emissionsberechnungen durchzuführen, benötigt ihr verschiedene Arten von Daten. Ein zentraler Punkt sind die Emissionsfaktoren eurer Lieferanten. Diese zeigen, wie viel CO₂-Äquivalent pro Einheit eines Produkts oder einer Dienstleistung entsteht. Viele größere Zulieferer können inzwischen produktspezifische Emissionsfaktoren bereitstellen, die deutlich genauer sind als allgemeine Branchendurchschnitte.
Für die Berechnung von Transportemissionen sind Mengenangaben und Gewichte unerlässlich. Erfasst dabei sowohl die Stückzahl als auch das Gewicht oder Volumen – bei Flüssigkeiten beispielsweise in Litern. Diese physischen Daten ermöglichen es, die Emissionen des Transports genau zu kalkulieren.
Auch die geografische Herkunft der Waren spielt eine große Rolle. Ein Stahlträger, der in Deutschland produziert wird, hat durch den lokalen Energiemix und kürzere Transportwege oft einen anderen CO₂-Fußabdruck als ein Produkt aus Übersee. Notiert daher die Produktionsstandorte eurer wichtigsten Lieferanten.
Bei energieintensiven Dienstleistungen wie Rechenzentren oder Logistikbetrieben sind Energieverbrauchsdaten entscheidend. Hier solltet ihr Informationen über den Stromverbrauch und den verwendeten Energiemix der Anbieter einholen.
Die Erfassung dieser Daten ist jedoch nicht immer einfach. Kleinere Lieferanten zeigen sich oft weniger kooperationsbereit, da sie möglicherweise keine eigenen Emissionsdaten erfasst haben. Während große Unternehmen ihre Zulieferer häufig zur Datenbereitstellung verpflichten können, fehlt KMU oft diese Verhandlungsmacht.
Ein weiteres Problem ist die Zersplitterung der Datenquellen. Die benötigten Informationen stammen von verschiedenen Stellen: Logistikdienstleister liefern Transportdaten, Hersteller die Produktinformationen und Rechenzentren die Energiedaten – und all das in unterschiedlichen Formaten.
Hinzu kommen begrenzte personelle Ressourcen. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen kann die manuelle Erfassung und Aufbereitung der Daten mehrere Arbeitstage pro Monat in Anspruch nehmen. Ohne eine klare Priorisierung wird die Aufgabe schnell unübersichtlich.
Ein weiteres Hindernis sind unvollständige oder veraltete Daten. Manche Lieferanten können nur Durchschnittswerte angeben, die sich seit der letzten Erhebung möglicherweise bereits verändert haben.
Es gibt jedoch Möglichkeiten, diese Herausforderungen zu meistern. Strukturierte Lieferantenbefragungen sind ein bewährter Ansatz. Mit standardisierten Fragebögen könnt ihr die wichtigsten Daten wie Emissionsfaktoren, Produktionsstandorte, Energiequellen und Transportwege erheben. Konzentriert euch dabei auf eure Top-20-Lieferanten nach Einkaufsvolumen – diese sind in der Regel für den Großteil eurer eingekauften Emissionen verantwortlich.
Wenn Lieferanten keine eigenen Daten bereitstellen können, bieten Branchendatenbanken und Durchschnittswerte eine praktikable Alternative. Institutionen wie die deutsche Umweltbehörde oder Branchenverbände stellen sektorspezifische Emissionsfaktoren zur Verfügung, die als Orientierung dienen können.
Eine weitere Möglichkeit ist die automatisierte Datenintegration über bestehende ERP-Systeme. Viele Warenwirtschaftssysteme erfassen bereits Lieferantendaten, Bestellmengen und Transportinformationen. Diese Daten lassen sich oft direkt für die Emissionsberechnung nutzen, was den manuellen Aufwand deutlich reduziert.
Ein stufenweiser Ansatz kann ebenfalls helfen, Ressourcen zu schonen. Beginnt mit groben Schätzungen auf Basis von Einkaufsvolumen und Branchendurchschnitten und verfeinert diese Daten im Laufe der Zeit bei den wichtigsten Lieferanten.
Die Kombination verschiedener Datenquellen – wie Lieferantendaten, Branchendurchschnitte und Plausibilitätsprüfungen – sorgt für eine höhere Genauigkeit. Diese mehrstufige Methode schafft eine solide Grundlage für die Analyse von Bereichen wie Transport oder Dienstleistungen und ermöglicht es euch, die Emissionen gezielt zu reduzieren.
Die manuelle Erfassung von Lieferkettendaten kann sich schnell als zeitintensiv und mühsam erweisen. Digitale Lösungen schaffen hier Abhilfe, indem sie den Prozess automatisieren und effizienter gestalten. Ein Beispiel hierfür ist die Plattform MULTIPLYE. Doch auch manuelle Ansätze haben ihre Berechtigung und sind vor allem für den Einstieg sinnvoll. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf beide Ansätze.
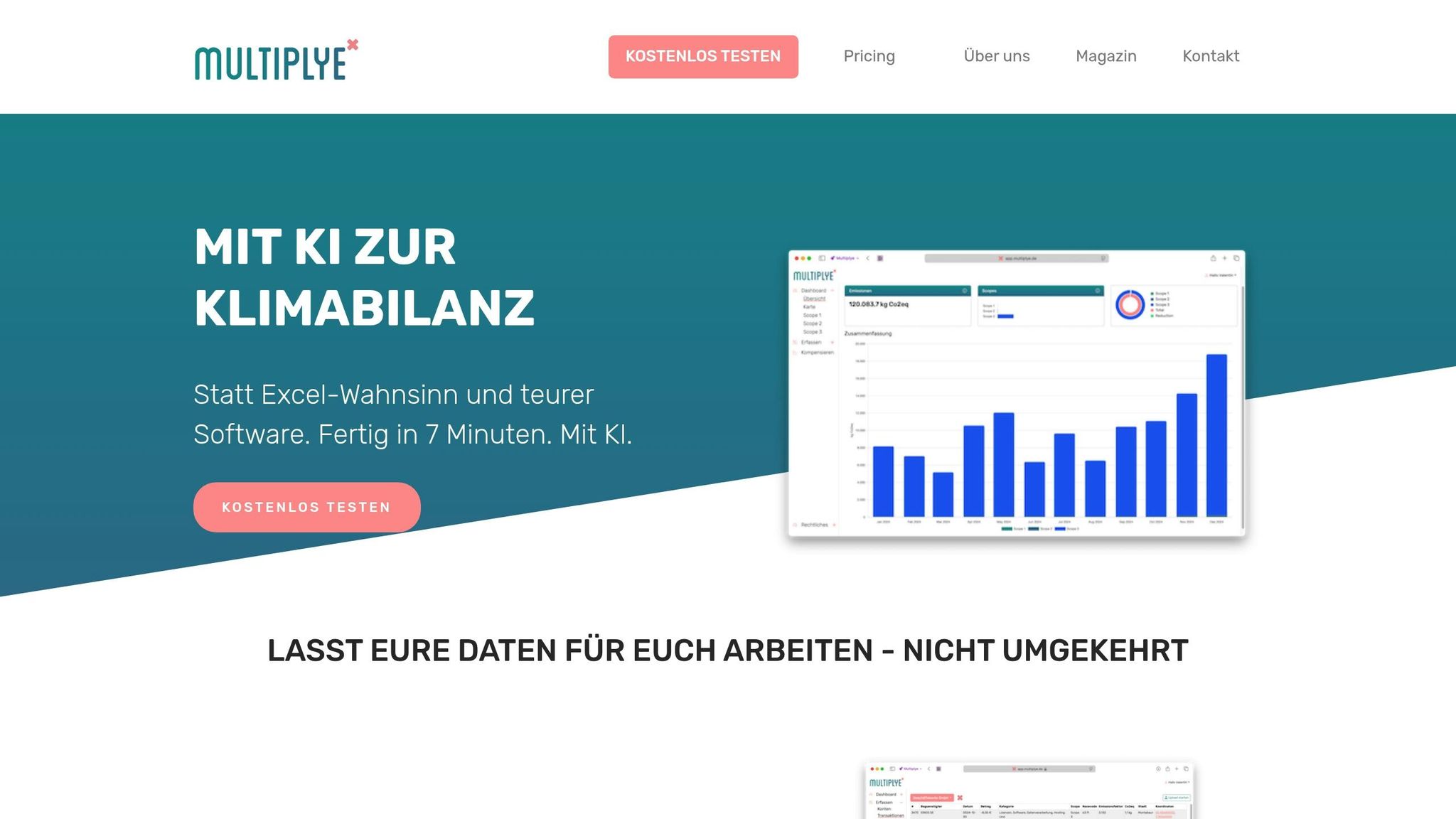
MULTIPLYE bietet kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Deutschland eine spezialisierte Plattform, um ihre CO₂-Bilanzierung zu automatisieren. Die Software basiert auf den Vorgaben des GHG-Protokolls und nutzt KI-gestützte Analysen, um Einsparpotenziale aufzudecken. Besonders für KMU ist die schnelle Verarbeitung der Daten durch die integrierte Analyse-KI ein großer Vorteil.
Die Plattform erstellt eine vollständige historische CO₂-Bilanz und kategorisiert die Emissionen nach Scope. Eine übersichtliche Heatmap zeigt auf einen Blick, welche Bereiche der Lieferkette die größten Emissionsquellen darstellen – eine wertvolle Hilfe bei der Priorisierung von Maßnahmen. Zudem bietet eine geografische Darstellung Einblicke in klimatische Risiken, indem sie aufzeigt, welche Lieferanten in besonders gefährdeten Regionen ansässig sind.
MULTIPLYE legt großen Wert auf Datenschutz: Das Hosting erfolgt auf sicheren Servern in Deutschland und erfüllt die Anforderungen der DSGVO. Interessierte Unternehmen können die Plattform sieben Tage lang unverbindlich testen. Die Premium-Version kostet 1.999 € im Jahr und umfasst neben persönlicher Beratung durch Experten auch geplante Zusatzfunktionen wie CO₂-Reduzierungsempfehlungen und Benchmarking.
Neben automatisierten Lösungen gibt es bewährte manuelle Ansätze, die insbesondere für den Einstieg geeignet sind. Eine Möglichkeit sind standardisierte Excel-Vorlagen, mit denen Lieferantendaten strukturiert erfasst werden können. Typische Spalten könnten Lieferantennamen, Produktkategorien, Einkaufsvolumen (in Euro), Gewicht (in Kilogramm) und das Herkunftsland umfassen.
Digitale Fragebögen sind eine weitere Option, um Daten effizient zu sammeln. Tools wie Google Forms oder Microsoft Forms ermöglichen es, Fragebögen direkt an Lieferanten zu senden. Die Antworten werden automatisch in Tabellen gespeichert und können weiterverarbeitet werden. Um die Rücklaufquote zu erhöhen, sollte der Fragebogen klar strukturiert sein und nicht mehr als 10–15 Fragen umfassen.
Für Unternehmen, die bereits ein ERP-System wie SAP Business One oder Microsoft Dynamics nutzen, bieten sich API-Schnittstellen an. Diese ermöglichen es, Stammdaten wie Bestellmengen, Lieferanteninformationen oder Transportdaten direkt zu übertragen und für die Emissionsberechnung zu nutzen.
Branchendatenbanken stellen sektorspezifische Emissionsfaktoren bereit und dienen als Fallback-Lösung, falls keine lieferantenspezifischen Daten verfügbar sind. Zwar sind diese Daten weniger präzise, bieten jedoch eine verlässlichere Grundlage als grobe Schätzungen.
KI-basierte Ansätze bieten gegenüber manuellen Methoden zusätzliche Möglichkeiten. Sie können große Datenmengen analysieren und Muster erkennen, die für das menschliche Auge oft verborgen bleiben. So lassen sich beispielsweise Emissionshotspots in der Lieferkette identifizieren, indem Daten aus verschiedenen Quellen miteinander verknüpft werden. Dabei berücksichtigt die KI nicht nur absolute Werte, sondern auch Trends und saisonale Schwankungen.
Mit Hilfe von Predictive Analytics können künftige Entwicklungen prognostiziert werden. So kann die KI etwa vorhersagen, wie sich die Scope-3-Emissionen verändern, wenn ein wichtiger Lieferant seine Produktion von Deutschland nach Asien verlagert – und das, bevor die Verlagerung tatsächlich erfolgt.
Automatisierte Plausibilitätsprüfungen sind ein weiterer Vorteil. Wenn beispielsweise die gemeldeten Emissionen eines Stahllieferanten deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegen, schlägt das System eine Überprüfung vor. Dies hilft, fehlerhafte Daten zu erkennen und ungenaue Bilanzen zu vermeiden.
Benchmarking-Funktionen runden das Angebot ab. Sie vergleichen die eigenen Emissionswerte mit Branchenstandards und ähnlichen Unternehmen, was KMU eine realistische Einschätzung ihrer Position ermöglicht. Gleichzeitig können so konkrete Reduktionsziele abgeleitet und Maßnahmen vorgeschlagen werden, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kosten und Emissionseinsparungen bieten.
Eine klare und transparente Verwaltung von Scope-3-Emissionen stellt besonders für KMU oft eine Herausforderung dar. Komplexe Daten und regulatorische Anforderungen verlangen gut durchdachte Prozesse.
Der erste Schritt zu einem effektiven Scope-3-Management ist die Festlegung klarer Ziele. Diese können sich auf Compliance, Risikomanagement oder die Erwartungen von Stakeholdern beziehen und bestimmen, wie umfangreich und detailliert eure Datenerfassung ausfallen sollte.
Ein vollständiger Überblick über eure aktuellen Scope-3-Emissionen – eine sogenannte Baseline – ist unerlässlich. Nur so lassen sich Fortschritte nachvollziehbar messen. Diese Baseline sollte regelmäßig aktualisiert werden, insbesondere bei wesentlichen Veränderungen.
Da Scope-3-Emissionen bis zu 75 % des gesamten CO₂-Fußabdrucks eines Unternehmens ausmachen können, ist es sinnvoll, sich auf wesentliche Kategorien wie eingekaufte Waren, Kraftstoffverbrauch und Logistik zu konzentrieren.
Regelmäßige Überwachung ist entscheidend – ob monatlich oder quartalsweise. Automatisierte Systeme können dabei helfen, Abweichungen schnell zu erkennen und darauf zu reagieren. Diese strukturierte Vorgehensweise schafft die Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Lieferanten und eine transparente Berichterstattung.
Eine enge Zusammenarbeit mit euren Lieferanten ist essenziell. Nachhaltigkeitskriterien sollten klar definiert und in den Einkaufsprozessen verankert werden.
Schulungen für Lieferanten können sicherstellen, dass Emissionsdaten korrekt erfasst werden. Gleichzeitig sollten klare Standards für nachhaltige Praktiken eingeführt werden.
Ein Beispiel für eine erfolgreiche Partnerschaft ist Lidl: Das Unternehmen fordert von Lieferanten, die 75 % der produktbezogenen Emissionen ausmachen, bis 2026 Ziele gemäß der Science Based Targets Initiative (SBTi) zu setzen.
Auch Anreize spielen eine wichtige Rolle. Nachhaltige Praktiken können beispielsweise durch bevorzugte Vertragsbedingungen oder längere Laufzeiten belohnt werden. Die Deutsche Telekom zeichnet solche Bemühungen mit ihren Green Future Best Practice Awards aus – eine der Kategorien widmet sich speziell der Reduktion von Scope-3-Emissionen.
Eine enge interne Zusammenarbeit innerhalb eures Unternehmens ist ebenfalls unverzichtbar. Sie bildet die Basis für eine glaubwürdige und transparente Kommunikation nach außen.
Für eine transparente Berichterstattung sollten Scope-3-Emissionen klar nach Kategorien gegliedert werden, wie es die Grundsätze des GHG-Protokolls vorsehen.
Da die Datenerhebung bei Scope-3-Emissionen oft mit Unsicherheiten verbunden ist, sind fundierte Schätzungen manchmal unvermeidlich. Wichtig ist, dass diese Schätzungen auf bewährten Berechnungsmodellen basieren und etwaige Anpassungen offen kommuniziert werden.
Nachhaltigkeitsberichte sollten den Standards der Global Reporting Initiative entsprechen. Lidl orientiert sich beispielsweise an diesen Standards, was zur Vergleichbarkeit und Vertrauenswürdigkeit seiner Berichte beiträgt.
Regelmäßige Kommunikation mit Stakeholdern ist ein weiterer wichtiger Baustein. Sie zeigt Fortschritte auf und stärkt das Vertrauen. Die Siemens AG ist hier ein Vorbild: Das Unternehmen berichtet umfassend über seinen CO₂-Fußabdruck und hat seit der Ankündigung seines Ziels der Klimaneutralität bereits eine Reduktion der Emissionen um 46 % erreicht.
Digitale Tools wie Online-Dashboards können komplexe Emissionsdaten anschaulich visualisieren und interaktiv zugänglich machen. Zusätzlich sorgt eine externe Validierung der Berichte für noch mehr Glaubwürdigkeit.
Der Einstieg in die Erfassung von Scope-3-Emissionen beginnt mit einer Materialitätsanalyse, die dabei hilft, die entscheidenden Kategorien innerhalb der Lieferkette zu bestimmen. So könnt ihr den Fokus gezielt auf die Bereiche legen, die den größten Einfluss haben.
Darauf aufbauend ist es sinnvoll, relevante Lieferanten einzubeziehen und Daten zu sammeln – etwa durch die Nutzung von Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten. Ein strukturierter Ansatz, wie die Entwicklung eines eigenen CO₂-Bilanzierungstools oder die Orientierung an bewährten Leitfäden zur Emissionsberechnung, erleichtert diesen Prozess erheblich und schafft eine solide Grundlage für systematisches Arbeiten.
Wichtig ist, mit den vorhandenen Ressourcen zu beginnen und die Prozesse nach und nach zu optimieren. Selbst einfache Ansätze können bereits eine spürbare Wirkung entfalten und den Weg in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft ebnen.
Um verlässliche Emissionsdaten von kleineren Lieferanten zu erhalten, ist eine enge Zusammenarbeit entscheidend. Dabei hilft es, klare Anforderungen an die Datenerfassung zu formulieren und eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Unterstützung in Form von Schulungen oder leicht verständlichen Leitfäden kann die Bereitschaft der Lieferanten zur Datenbereitstellung erheblich steigern.
Sollten spezifische Emissionsdaten nicht verfügbar sein, können branchenspezifische Durchschnittswerte oder Schätzungen herangezogen werden, um zumindest eine erste Orientierung zu erhalten. Digitale Tools und standardisierte Fragebögen bieten dabei eine praktische Möglichkeit, die Datenerhebung zu vereinfachen und auch für kleinere Lieferanten handhabbar zu machen.
Durch diese Ansätze können KMU sicherstellen, dass sie trotz begrenzter Ressourcen ihrer Lieferanten die notwendigen Informationen erhalten und ihre Scope-3-Emissionen gezielt und effizient managen.
Automatisierte Tools wie MULTIPLYE machen die Berechnung von Scope-3-Emissionen deutlich einfacher und bringen klare Vorteile gegenüber manuellen Ansätzen mit sich. Sie ermöglichen eine schnelle und präzise Erfassung von Daten, reduzieren Fehlerquellen und sparen sowohl Zeit als auch Ressourcen – ein entscheidender Vorteil, insbesondere für KMU, die häufig mit begrenzten Budgets und Kapazitäten arbeiten müssen.
Ein weiterer Pluspunkt: Solche Tools schaffen mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit in der Lieferkette. Das erleichtert nicht nur die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen, sondern auch die Berichterstattung gegenüber Geschäftspartnern und Behörden. Mit moderner Technologie können Unternehmen ihre Abläufe effizienter gestalten und den Fokus verstärkt auf strategische Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit legen.