Melde dich jetzt für die Warteliste an.
Für Warteliste anmelden
Für Warteliste anmelden

CO2-Bilanzierung leicht gemacht: Eure Finanzdaten aus der Steuerberatung können eine solide Grundlage sein, um eure CO2-Emissionen einfach und effizient zu berechnen. Rechnungen für Strom, Kraftstoff oder Geschäftsreisen enthalten bereits viele Informationen, die ihr benötigt. Mit der richtigen Herangehensweise spart ihr Zeit, Kosten und seid bestens auf künftige Anforderungen vorbereitet.
Warum das wichtig ist? Ab 2026 wird die CSRD für viele Unternehmen verpflichtend. Auch KMU profitieren, wenn sie frühzeitig ihre CO2-Bilanz erstellen: bessere Finanzierungsmöglichkeiten, Wettbewerbsvorteile und eine stärkere Marktposition. Der Schlüssel liegt in der cleveren Nutzung eurer bestehenden Buchhaltungsdaten – ohne von null zu starten.
Kurz zusammengefasst:
Mit diesen Schritten legt ihr den Grundstein für eine effiziente CO2-Bilanzierung und stärkt gleichzeitig eure Zukunftsfähigkeit.
Jeder ausgegebene Euro hinterlässt einen ökologischen Fußabdruck – das ist die Basis des sogenannten Spend-based Approach. Dabei werden finanzielle Ausgaben mithilfe von Emissionsfaktoren in CO2-Äquivalente umgerechnet. Um eine präzise CO2-Bilanz zu erstellen, ist die enge Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen in den Bereichen Finanzen und Einkauf entscheidend.
Die Idee, dass jeder Euro Emissionen verursacht, erfordert die Analyse spezifischer Finanzdaten. Steuerberater und Finanzabteilungen liefern hierfür wichtige Informationen, die direkt für die Emissionsberechnung genutzt werden können. Eine konsolidierte Übersicht der Ausgaben nach Einkaufstypen, idealerweise ergänzt um die Lieferantennamen, bildet die Grundlage.
Bei produzierenden Unternehmen ist es entscheidend, tatsächliche Lagereinkäufe zu berücksichtigen, anstatt sich ausschließlich auf die Umsatzkosten aus der Gewinn- und Verlustrechnung zu stützen. Denn das GuV-Matching-Prinzip spiegelt oft nicht den CO2-Fußabdruck der im Berichtsjahr eingekauften Waren wider. Investitionsgüter wie Maschinen und Anlagen erfordern eine gesonderte Betrachtung. Hier sollte das Finanzteam eine detaillierte Liste aller Anschaffungen bereitstellen, die unter Scope 3, Kategorie 2 fallen. Diese sollte sowohl physische Vermögenswerte als auch aktivierte Dienstleistungen wie Installation oder Beratung umfassen.
Das Greenhouse Gas Protocol teilt Emissionen in drei Bereiche (Scopes) ein, die sich aus Finanzdaten ableiten lassen:
Beispiele für Scope 3, Kategorie 1 (eingekaufte Waren und Dienstleistungen) sind Rohstoffe wie Kunststoff (2,4 Mio. €), Holz (2,0 Mio. €) oder Verpackungen (1,3 Mio. €). Auch indirekte Ausgaben wie Marketing (3,5 Mio. €), Rechts- und Prüfungsdienstleistungen (2,2 Mio. €) oder IT-Services (1,1 Mio. €) fallen hierunter.
Eine besondere Herausforderung stellen Leasingverhältnisse dar (Scope 3, Kategorie 8). Hier ist die Klassifizierung entscheidend: Handelt es sich um Operating-Leasing unter finanzieller Kontrolle, werden Emissionen aus Kraftstoff und Stromverbrauch in Scope 3 erfasst. Beim Finanzierungsleasing hingegen gehören Kraftstoffemissionen zu Scope 1 und der Stromverbrauch zu Scope 2.
Sobald die Emissionen den Scopes zugeordnet sind, müssen Unternehmen auch regulatorische Vorgaben berücksichtigen. In Deutschland wachsen die Anforderungen an die Berichterstattung stetig. Ab 2026 betrifft die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zunächst nur große Unternehmen. Doch auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die mit berichtspflichtigen Firmen zusammenarbeiten, werden indirekt zur Offenlegung ihrer CO2-Daten angehalten.
Für KMU ist es daher essenziell, die Daten aus den vorherigen Schritten korrekt aufzubereiten. Dabei sollten irrelevante Ausgaben wie Steuern oder Gehälter ausgeschlossen werden. Ebenso sind Ausgaben, die anderen Scope-3-Kategorien zugeordnet werden, wie Flugkosten (Kategorie 6) oder Produktversand (Kategorie 4), separat zu behandeln. Um Doppelzählungen zu vermeiden, sollten Intercompany-Transaktionen eliminiert werden. Falls Standortdaten fehlen, können Durchschnittswerte herangezogen werden, um das Vollständigkeitsprinzip des GHG Protocol zu erfüllen.
Mit euren vorhandenen Finanzdaten könnt ihr systematisch eine präzise CO2-Bilanz erstellen. Der Schlüssel liegt darin, die Daten strukturiert aufzubereiten und mit den passenden Emissionsfaktoren zu verknüpfen. Hier zeigen wir euch, wie das funktioniert.
Der erste Schritt führt euch in die Buchhaltung oder zum Steuerberater. Fordert eine Jahresaufstellung an, die nach Ausgabentypen und Lieferanten gegliedert ist. Diese Daten sollten in einem tabellarischen Format wie Excel oder CSV vorliegen.
Für produzierende Unternehmen ist es sinnvoll, die tatsächlichen Lagereinkäufe einzubeziehen, statt sich nur auf die Umsatzkosten aus der Gewinn- und Verlustrechnung zu stützen. Achtet darauf, dass alle Beträge in Euro und im deutschen Zahlenformat vorliegen. Wichtig ist auch, dass die Zahlen aus demselben Geschäftsjahr stammen und die Mehrwertsteuer einheitlich behandelt wird.
Im nächsten Schritt ordnet ihr den einzelnen Ausgabenkategorien spezifische Emissionsfaktoren zu. Für Strom verwendet ihr beispielsweise den aktuellen deutschen Strommix-Faktor, für Erdgas den gültigen Emissionsfaktor. Bei eingekauften Waren und Dienstleistungen kommen branchenspezifische Faktoren ins Spiel. Kunststoffrohstoffe haben oft höhere Emissionen, während Materialien wie Holz in der Regel niedrigere Werte aufweisen. Auch Dienstleistungen wie IT-Services oder Beratung werden häufig mit monetären Emissionsfaktoren bewertet, die sich an Branchenstandards orientieren.
Um die Berechnungen über mehrere Jahre hinweg konsistent zu halten, empfiehlt es sich, eine Zuordnungstabelle zu erstellen. Diese verknüpft die Kontenklassen eurer Buchhaltung mit den Scope-3-Kategorien des GHG Protocol.
Moderne Tools können diesen Prozess erheblich erleichtern. Manuelle Berechnungen sind nicht nur zeitaufwendig, sondern auch fehleranfällig. Softwarelösungen wie MULTIPLYE automatisieren die Zuordnung und Berechnung, indem sie die passenden Emissionsfaktoren automatisch anwenden.
MULTIPLYE erkennt dabei nahezu eigenständig die Ausgabenkategorien und ordnet sie den entsprechenden GHG-Protocol-Scopes zu. Komplexe Fälle wie Leasing oder Investitionsgüter werden ebenfalls korrekt berücksichtigt. Dank maschinellem Lernen wird die Kategorisierung kontinuierlich verbessert, wodurch der manuelle Aufwand weiter sinkt.
Ein großer Vorteil solcher Tools ist die Standardisierung. Während manuelle Methoden oft zu Inkonsistenzen führen, sorgt die Software für einheitliche Berechnungsprozesse – besonders wichtig, wenn ihr eure CO2-Bilanz regelmäßig erstellt oder verschiedene Standorte vergleichen möchtet.
Zum Abschluss ist eine gründliche Qualitätskontrolle unerlässlich. Überprüft, ob alle relevanten Ausgabenkategorien erfasst sind und keine wichtigen Lieferanten oder Kostenblöcke fehlen.
Ein bewährtes Verfahren ist der Plausibilitätscheck durch Benchmarking. Vergleicht eure spezifischen Emissionen (z. B. CO2e pro Euro Umsatz) mit branchenüblichen Durchschnittswerten. Weichen eure Ergebnisse stark ab, solltet ihr die zugrunde liegenden Daten und Emissionsfaktoren nochmals prüfen.
Besondere Aufmerksamkeit verdienen Buchungsposten, die einen großen Anteil an den Gesamtemissionen haben. Häufige Fehlerquellen sind falsch kategorisierte Investitionsgüter, doppelte Erfassungen oder ungeeignete Emissionsfaktoren.
Dokumentiert alle Annahmen und Datenquellen sorgfältig. Das erleichtert nicht nur externe Prüfungen, sondern auch künftige Aktualisierungen eurer CO2-Bilanz.
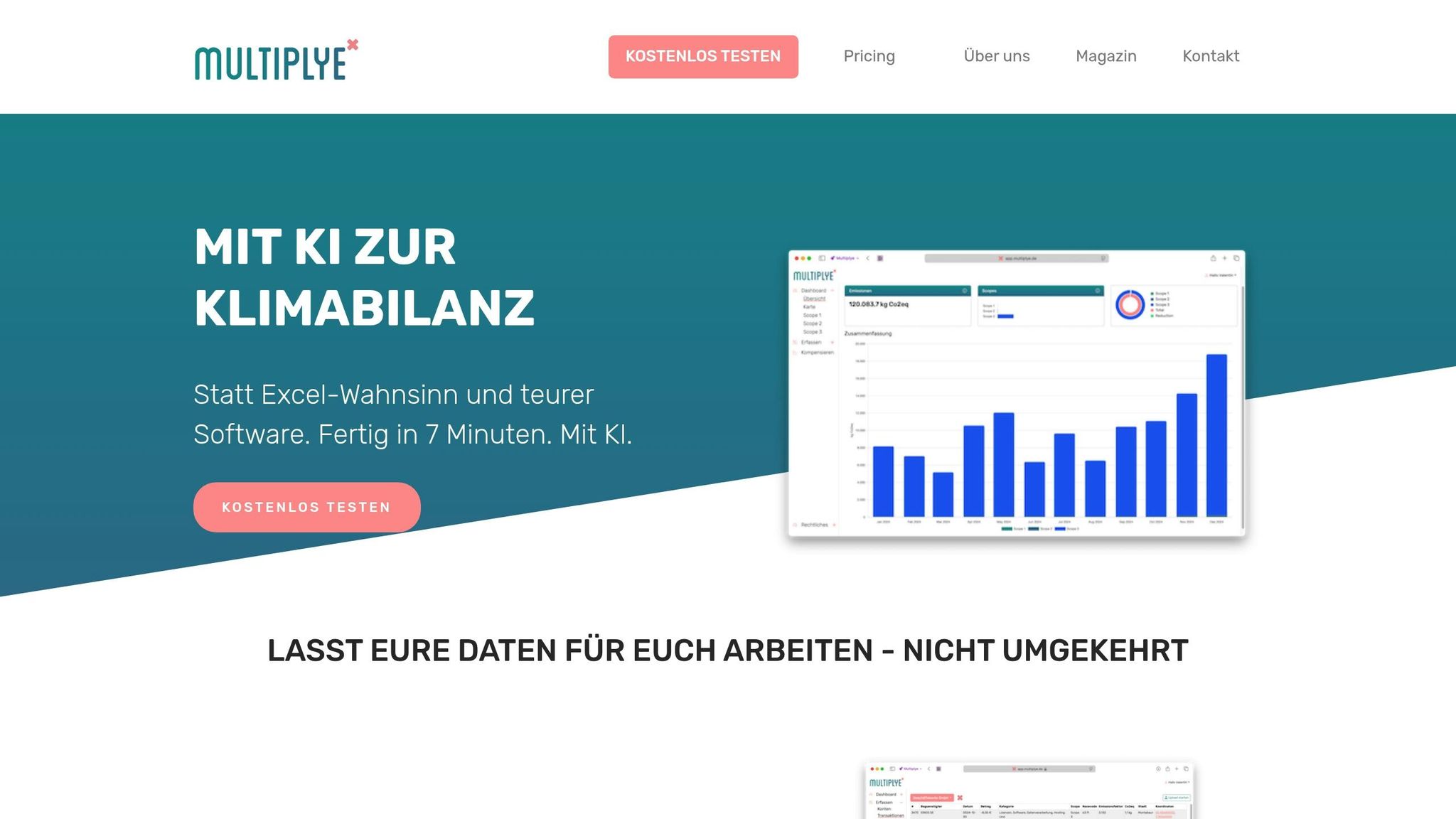
Die CO₂-Bilanzierung kann für KMU eine echte Herausforderung sein – zeitaufwändig und oft komplex. Genau hier setzt MULTIPLYE an: Die Plattform bietet eine automatisierte Lösung, die Finanzdaten nutzt, um die CO₂e-Bilanz effizient zu ermitteln und darzustellen. Entwickelt speziell für deutsche Unternehmen, erfüllt MULTIPLYE die EU-Vorgaben zur Nachhaltigkeit und sorgt so für eine reibungslose Integration in bestehende Prozesse.
MULTIPLYE analysiert eure Buchhaltungsdaten mithilfe von KI, ordnet sie den Scopes des GHG-Protokolls zu und verarbeitet die Informationen DSGVO-konform direkt in Deutschland.
Besonders praktisch: Eine intuitive Heatmap sowie eine geografische Übersicht verschaffen euch schnell Klarheit über eure CO₂e-Bilanz. Damit lassen sich nicht nur zentrale Emissionsquellen aufdecken, sondern auch Klimarisiken besser bewerten. Und das Beste: Die Plattform lässt sich nahtlos in eure bestehenden Buchhaltungssysteme integrieren.
Die Verbindung mit euren Buchhaltungssystemen erfolgt über standardisierte Schnittstellen. Es ist denkbar einfach: Finanzdaten im Excel- oder CSV-Format hochladen, und MULTIPLYE übernimmt den Rest. Sogar historische Daten können rückwirkend analysiert werden, um langfristige Trends in der Emissionsentwicklung sichtbar zu machen.
Durch die Automatisierung reduziert ihr nicht nur den Zeitaufwand, sondern minimiert auch Fehlerquellen. Falls jedoch Fragen zur Interpretation der Ergebnisse oder zu branchenspezifischen Besonderheiten auftauchen, bietet euch das MULTIPLYE Premium-Team persönliche Unterstützung.
Und das ist noch nicht alles: MULTIPLYE plant, in Zukunft KI-gestützte Vorschläge zur Emissionsreduktion einzuführen. Neben der Analyse eurer aktuellen Emissionen sollen konkrete Maßnahmen zur Reduktion des CO₂-Fußabdrucks empfohlen werden. Ergänzend dazu wird ein Benchmarking-Tool verfügbar sein, mit dem ihr eure Leistung mit anderen Unternehmen eurer Branche vergleichen könnt. Ein echter Mehrwert für eure Nachhaltigkeitsstrategie!
Mit der automatisierten Erfassung eurer CO₂-Daten durch MULTIPLYE habt ihr den ersten Schritt gemacht. Doch wie lassen sich diese Erkenntnisse in konkrete Maßnahmen umwandeln? Die CO₂-Bilanzierung liefert die Basis – jetzt geht es darum, gezielt Emissionen zu senken. Dabei profitiert ihr nicht nur von der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, sondern auch von Einsparungen und Wettbewerbsvorteilen.
Um gezielt Emissionen zu reduzieren, ist ein detailliertes Verständnis eures CO₂-Fußabdrucks unverzichtbar. Eine umfassende Analyse aller drei Scopes – also direkter Emissionen, eingekaufter Energie und der gesamten Wertschöpfungskette – bildet die Grundlage für langfristige Strategien und glaubwürdige Berichterstattung.
Besonders hilfreich ist dabei die Analyse eurer Finanzdaten, die oft unerwartete Emissionsquellen offenlegt:
Ein Beispiel aus der Praxis: Das Hamburger Unternehmen Traceless Materials, das abbaubare Materialien aus landwirtschaftlichen Abfällen herstellt, nutzt Lebenszyklusanalysen, um den gesamten Fußabdruck zu bewerten – von der Beschaffung bis zur Entsorgung, inklusive Transport und indirekter Lieferkettenemissionen.
MULTIPLYE bietet euch hier eine Heatmap-Funktion, die auf einen Blick zeigt, welche Lieferanten oder Kostenstellen die höchsten Emissionen verursachen. Dabei wird schnell klar, dass nicht nur Energie oder Transport eine Rolle spielen. Auch eingekaufte Materialien oder Dienstleistungen können erhebliche Beiträge leisten.
Sobald ihr die größten Emissionsquellen identifiziert habt, könnt ihr gezielt Maßnahmen ergreifen. Das Prinzip: Beginnt mit den Bereichen, die bei geringem Aufwand die größte Wirkung zeigen.
Auch kleine Veränderungen machen einen Unterschied: Fahrgemeinschaften, Home-Office-Regelungen oder optimierte Tourenpläne können Emissionen senken – und das ohne große Investitionen.
Die geografische Übersicht in MULTIPLYE zeigt zudem regionale Unterschiede im Strommix auf. Besonders für Unternehmen mit mehreren Standorten ist das ein wertvolles Werkzeug, um gezielt Maßnahmen zu planen.
Scope-3-Emissionen erfordern oft ein Umdenken. Lieferantenbewertungen, alternative Materialien und die Integration von Kreislaufwirtschaft sind hier entscheidend. Zukünftige KI-gestützte Funktionen von MULTIPLYE sollen euch dabei branchenspezifische Empfehlungen liefern – von der Beschaffung bis hin zu neuen Produktionsmethoden.
Selbst mit den besten Strategien lassen sich nicht alle Emissionen vermeiden. Für diesen Restanteil kommen zertifizierte Klimaprojekte ins Spiel – aber nur, wenn sie glaubwürdig und transparent sind.
MULTIPLYE bietet ausschließlich Projekte mit mindestens BBB-Rating an, die nachweislich positive Klimawirkungen erzielen. Die Bandbreite reicht von Aufforstung über erneuerbare Energien bis hin zu Technologien zur CO₂-Abscheidung. Wichtig ist die Reihenfolge: Erst reduzieren, dann kompensieren.
Ein Beispiel: Verursacht ein Unternehmen 100 Tonnen CO₂e pro Jahr, sollte es zunächst versuchen, diesen Wert durch interne Maßnahmen auf 50 Tonnen zu senken. Die verbleibenden 50 Tonnen können dann durch Klimaprojekte ausgeglichen werden. Das ist nicht nur kosteneffizient, sondern auch für Kunden und Stakeholder nachvollziehbar.
Die Ergebnisse sprechen für sich: Bis zu 95 % weniger Treibhausgasemissionen bei Produktion und Entsorgung, durchschnittlich 2,59 Tonnen CO₂-Äquivalent Einsparung pro Tonne Material sowie Einsparungen zwischen 26 % und 76 % über den gesamten Lebenszyklus – das entspricht 1,55 Tonnen CO₂-Äquivalent pro produzierter Tonne.
Die Kombination aus datenbasierter Analyse, gezielten Maßnahmen und hochwertiger Kompensation macht die CO₂-Bilanzierung zu einem kraftvollen Werkzeug. So könnt ihr nicht nur eure Klimaziele erreichen, sondern auch euer Unternehmen nachhaltig und zukunftssicher aufstellen.
Die CO₂-Bilanzierung nach deutschen und europäischen Standards verlangt weit mehr als nur das Sammeln von Daten. Für KMU, die auf Steuerberaterdaten zurückgreifen, sind vor allem spezifische Formatierungsrichtlinien und regulatorische Vorgaben von Bedeutung. Mit der CSRD steigt die Zahl der berichtspflichtigen Unternehmen in Europa von 11.000 auf fast 50.000. Deutsche Unternehmen müssen dabei nicht nur ihre CO₂-Emissionen erfassen, sondern auch die doppelte Wesentlichkeit berücksichtigen. Das bedeutet, sowohl die Auswirkungen des Klimas auf das Unternehmen als auch den Einfluss des Unternehmens auf Klima und Gesellschaft zu bewerten. Im Folgenden zeigen wir, wie die Einhaltung deutscher Formate und Einheiten Ihre Berichterstattung effizienter gestalten kann.
Die richtige Formatierung der CO₂-Daten ist nicht nur eine Frage der Genauigkeit, sondern auch der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Für deutsche Unternehmen ist es unerlässlich, das deutsche Zahlenformat zu verwenden – also Komma als Dezimaltrennzeichen und Punkt als Tausendertrennzeichen. Ein Beispiel: 1.250.500,75 Tonnen CO₂e (statt 1,250,500.75 Tonnen CO₂e).
Zusätzlich sollten folgende Standards eingehalten werden:
Diese Konsistenz in der Darstellung ist besonders relevant, wenn Berichte von deutschen Behörden oder Wirtschaftsprüfern geprüft werden. Tools wie MULTIPLYE berücksichtigen diese Standards automatisch und gewährleisten, dass Berichte den lokalen Formatierungsanforderungen entsprechen. Neben der Formatierung spielt auch die Einhaltung regulatorischer Vorgaben eine zentrale Rolle.
Die CSRD sowie die European Sustainability Reporting Standards (ESRS) setzen klare Maßstäbe für die CO₂-Berichterstattung in Deutschland. Das GHG Protocol teilt Emissionen in Scope 1, 2 und 3 ein.
Wichtig ist, dass Unternehmen ihre gesamten Treibhausgasemissionen in CO₂-Äquivalenten (CO₂e) angeben und nicht nur reines CO₂. Das schließt die Umrechnung von Methan, Lachgas und anderen Treibhausgasen entsprechend ihrer Klimawirkung ein. Darüber hinaus müssen Nachhaltigkeitsdaten in einem standardisierten digitalen Format eingereicht und einer unabhängigen Prüfung unterzogen werden.
Ab dem dritten Quartal 2024 wird der Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) zusätzliche Anforderungen an Unternehmen stellen, die kohlenstoffintensive Produkte in die EU importieren. Hier müssen tatsächliche Emissionsdaten der Produktionsstätten vorgelegt werden.
Zudem sind deutsche Unternehmen verpflichtet, einen Emissionsreduktionsplan vorzulegen, der mit dem Paris-Abkommen kompatibel ist und bis 2050 Netto-Null-Emissionen anstrebt. Dies erfordert nicht nur die Erfassung des aktuellen Status quo, sondern auch die Entwicklung konkreter Zielpfade und Maßnahmenpläne. Die Integration von Steuerberaterdaten in diese Prozesse kann dabei helfen, kosteneffiziente Reduktionsstrategien zu entwickeln und gleichzeitig die Compliance sicherzustellen.
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben die Möglichkeit, ihre Finanzdaten gezielt zu nutzen, um ihren CO2-Fußabdruck genau zu berechnen. Indem ihr Buchhaltungsdaten wie Energieverbrauch, Materialkosten oder Transportausgaben systematisch analysiert, könnt ihr die relevanten Emissionsquellen aufdecken und den CO2-Ausstoß präzise bestimmen.
Mit spezialisierten CO2-Bilanzierungstools lassen sich diese Daten unkompliziert in die Berechnungen einfügen. Das spart nicht nur Zeit und reduziert den manuellen Aufwand, sondern unterstützt auch eine nachhaltigere Unternehmensstrategie. Auf diese Weise könnt ihr eure Emissionen nicht nur besser überwachen, sondern auch gezielte Maßnahmen zur Reduktion einleiten – ein Ansatz, der langfristig sowohl eure Kosten senkt als auch einen Beitrag zum Umweltschutz leistet.
Ab 2026 bringt die CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) für viele KMU neue Herausforderungen mit sich. Besonders betroffen sind sie von erweiterten Berichtspflichten rund um Nachhaltigkeit und CO2-Emissionen. Dabei stehen sie vor Aufgaben wie der Erfassung und Strukturierung relevanter Daten, der Sicherstellung einer hohen Datenqualität und der Anpassung an neue Berichtsstandards.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist es ratsam, frühzeitig aktiv zu werden. KMU sollten systematische Prozesse zur Datenerfassung aufbauen und klare Verantwortlichkeiten innerhalb des Unternehmens festlegen. Gleichzeitig lohnt es sich, sich intensiv mit den neuen Standards auseinanderzusetzen. Falls nötig, kann der Einsatz von externer Beratung helfen, die Einhaltung der Vorgaben effizient und rechtzeitig umzusetzen. Mit diesen Maßnahmen erfüllen Unternehmen nicht nur die gesetzlichen Anforderungen, sondern treiben auch ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele gezielt voran.
Automatisierte Werkzeuge wie MULTIPLYE bieten kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) eine praktische Möglichkeit, ihre CO₂-Bilanzierung effizienter und genauer umzusetzen – und das zu überschaubaren Kosten. Die automatische Datenerfassung und Echtzeit-Analysen sparen nicht nur Zeit, sondern auch wertvolle Ressourcen.
Ein weiterer Vorteil: Diese Tools schaffen mehr Transparenz, indem sie Emissionsquellen schnell sichtbar machen und gezielte Verbesserungen ermöglichen. Damit können KMU nicht nur ihre Nachhaltigkeitsziele leichter erreichen, sondern sich auch langfristig im Wettbewerb besser positionieren.