Melde dich jetzt für die Warteliste an.
Für Warteliste anmelden
Für Warteliste anmelden

Die CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) fordert Unternehmen auf, über Wasser- und Biodiversitätsrisiken genauso detailliert zu berichten wie über CO₂-Emissionen.
Hier sind die wichtigsten Punkte, die Sie wissen müssen:
Warum das wichtig ist: Über 75 % der globalen Nahrungsmittelproduktion hängen von der Natur ab. Unternehmen, die die neuen Anforderungen erfüllen, sichern ihre Zukunft und schaffen Wettbewerbsvorteile.
Die European Sustainability Reporting Standards (ESRS) bilden die Grundlage der CSRD und legen klare Vorgaben für die Berichterstattung zu Wasser- und Biodiversitätsthemen fest. Mit diesen Standards wird die Nachhaltigkeitsberichterstattung für etwa 49.000 europäische Unternehmen verpflichtend und einheitlich geregelt. Insbesondere Wasser und Biodiversität stehen dabei im Fokus der spezifischen Anforderungen.
ESRS E3 widmet sich der Wasserberichterstattung. Unternehmen müssen detaillierte Informationen zu ihrem Wasserverbrauch, Abwasser, Verschmutzung sowie zu den Auswirkungen auf Ökosysteme offenlegen. Für Aktivitäten in Meeresgebieten sind zusätzliche Angaben zu Abhängigkeiten, Auswirkungen und spezifischen Kennzahlen erforderlich.
ESRS E4 konzentriert sich auf Biodiversität und Ökosysteme und umfasst sechs zentrale Offenlegungsanforderungen: die Biodiversitätsstrategie des Unternehmens, das Management von Auswirkungen, Risiken und Chancen sowie die dazugehörigen Ziele und Kennzahlen. Unternehmen sind verpflichtet, messbare Zielsetzungen mit klaren KPIs offenzulegen.
Ein wichtiges Prinzip der Standards ist die Maßnahmenhierarchie: "Vermeiden - Reduzieren - Wiederherstellen - Kompensieren". Dabei liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Kompensation negativer Auswirkungen. Die Zielvorgaben müssen sich an internationalen Abkommen wie der Konvention über die biologische Vielfalt oder dem Europäischen Green Deal orientieren.
Ein herausragendes Merkmal von ESRS E4 ist der doppelte Wesentlichkeitsansatz, der sowohl die Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft als auch finanzielle und ökologische Risiken berücksichtigt. Unternehmen müssen ihre Strategien zur Identifizierung, Bewertung und Verwaltung von Biodiversitätsauswirkungen darlegen und diese mit konkreten Maßnahmen und Ressourcen verknüpfen.
Zusätzlich zu den ESRS-Standards gibt es rechtliche Rahmenbedingungen auf EU- und nationaler Ebene. Die EU-Naturwiederherstellungsverordnung (NRR), die 2024 in Kraft trat, verpflichtet die Mitgliedstaaten, bis September 2026 Nationale Wiederherstellungspläne (NRP) vorzulegen. Ziel ist es, bis 2030 mindestens 20 % der Land- und Meeresgebiete der EU und bis 2050 alle beeinträchtigten Ökosysteme wiederherzustellen.
In Deutschland wird die EU-Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt. Doch laut Umweltbundesamt werden bis 2027 voraussichtlich nur 18 % der Oberflächengewässer einen guten ökologischen Zustand erreichen. Die EU-Verordnung 2020/741 setzt zudem Mindeststandards für die Wiederverwendung von Wasser, insbesondere in der landwirtschaftlichen Bewässerung, um Wasserknappheit zu verringern.
"Wasser ist kein handelsübliches Gut wie jedes andere, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss ... Es ist notwendig, eine integrierte Gemeinschaftspolitik im Bereich Wasser zu entwickeln." – Auszug aus den Erwägungsgründen zur Europäischen Wasserrahmenrichtlinie
Deutsche Unternehmen sind verpflichtet, ihre Auswirkungen auf die Biodiversität bis 2030 zu messen und zu berichten. Großunternehmen mit mindestens 500 Mitarbeitenden starten bereits 2024, während kleinere Unternehmen ab 2028 folgen. Diese Maßnahmen sind dringend notwendig, da über 80 % der Lebensräume in Europa in schlechtem Zustand sind und ein Drittel der Bienen- und Schmetterlingsarten rückläufig ist.
Ein besonderes Problem in Deutschland sind die entwässerten Moorböden, die etwa 1,8 Millionen Hektar umfassen. Über 90 % dieser Flächen sind entwässert und werden intensiv landwirtschaftlich genutzt. Obwohl sie nur rund 13,5 % der landwirtschaftlichen Fläche ausmachen, verursachen sie etwa 37 % der Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft in Deutschland.
Die systematische Erfassung von Wasser- und Biodiversitätsrisiken bildet die Grundlage für Berichte gemäß der CSRD. Deutsche Unternehmen stehen dabei vor der Aufgabe, komplexe Umweltrisiken zu bewerten, die oft weit über ihre direkten Betriebsstätten hinausgehen. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, sind strukturierte Ansätze und bewährte Methoden unverzichtbar.
Die doppelte Wesentlichkeitsanalyse ist ein zentraler Bestandteil der CSRD. Sie fordert Unternehmen auf, Nachhaltigkeit aus zwei Perspektiven zu betrachten: der finanziellen Wesentlichkeit und der Auswirkungswesentlichkeit. Für Wasser- und Biodiversitätsrisiken bedeutet dies, sowohl die Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf Ökosysteme als auch die finanziellen Risiken durch Umweltveränderungen zu berücksichtigen.
Der Prozess beginnt mit einer Analyse des Kontexts und der gesamten Wertschöpfungskette. Dabei identifizieren Unternehmen branchenspezifische Nachhaltigkeitsthemen entlang ihrer Lieferkette. Mithilfe von ESRS, Branchenberichten und Wettbewerbsanalysen wird eine Liste relevanter Themen erstellt. Die Einbindung von Stakeholdern hilft dabei, diese Themen zu priorisieren und zu verfeinern. Abschließend werden die Auswirkungen, Risiken und Chancen (IROs) bewertet, wobei Kriterien wie Schweregrad und Wahrscheinlichkeit eine zentrale Rolle spielen. Digitale Tools erleichtern die praktische Umsetzung dieser Analysen.
Digitale Tools spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Wasser- und Biodiversitätsrisiken. Sie ermöglichen es Unternehmen, Risiko-Hotspots zu identifizieren und Prioritäten zu setzen.
| Tool | Beschreibung | Anwendungsbereich |
|---|---|---|
| ENCORE | Untersucht naturbasierte Risiken und Abhängigkeiten; zeigt, wie wirtschaftliche Aktivitäten von der Natur abhängen und diese beeinflussen | Umfassende Naturrisiko-Analyse |
| WWF Risk Filter | Online-Tool zur Identifikation von Biodiversitäts- und Wasserrisiken an spezifischen Standorten | Risiko-Hotspot-Identifikation |
| IBAT | Zugriff auf zentrale Biodiversitätsdatenbanken zur Identifikation von Gebieten mit hoher Biodiversität | Ermittlung von Schutzgebieten und bedrohten Arten |
| Water Risk Atlas (WRI) | Detaillierte Daten zu globaler Wasserknappheit und -risiken, besonders relevant für wasserintensive Branchen | Wasserbezogene Risikoanalyse |
| Copernicus | EU-Erdbeobachtungsprogramm zur Überwachung von Umweltveränderungen mithilfe von Satellitendaten | Umweltüberwachung und Risikobewertung |
In Pilotprojekten wurden Tools wie der WWF Risk Filter und ENCORE genutzt, um naturbasierte Risiken an Unternehmensstandorten zu identifizieren. Das IBAT-Tool half, Gebiete mit hoher Biodiversität und Schutzbedarf zu bestimmen, während der Water Risk Atlas insbesondere in wasserintensiven Branchen zur Analyse von Risiken wie Wasserknappheit oder Überschwemmungen eingesetzt wurde. Diese Tools sind nicht nur für interne Analysen nützlich, sondern auch für die Bewertung entlang der gesamten Lieferkette.
Neben der internen Analyse ist es entscheidend, Risiken in der Lieferkette systematisch zu erfassen. Für eine vollständige CSRD-Compliance müssen Unternehmen nicht nur ihre eigenen Standorte, sondern auch kritische Punkte in vor- und nachgelagerten Aktivitäten bewerten. Die Berücksichtigung der gesamten Wertschöpfungskette ist dabei unerlässlich.
Nach der systematischen Bewertung von Wasser- und Biodiversitätsrisiken ist der nächste Schritt, diese Themen in den Alltag der Geschäftsführung einzubinden. Deutsche Unternehmen stehen vor der Aufgabe, Wasser- und Biodiversitätsaspekte strategisch in ihre Governance, Prozesse und Berichterstattung zu integrieren, um langfristig widerstandsfähiger zu werden. Dafür braucht es messbare Ziele und die Einbindung aller relevanten Stakeholder. Etwa die Hälfte des globalen BIP hängt von natürlichen Ressourcen und Ökosystemleistungen ab. Aufbauend auf den identifizierten Risiken setzen Unternehmen klare Ziele und definieren dazu passende Kennzahlen.
Die CSRD fordert, dass Unternehmen spezifische Kennzahlen und Leistungsindikatoren im Bereich Biodiversität veröffentlichen. Diese KPIs sollten einerseits umfassend, andererseits praktikabel sein und die Marke, das Geschäftsmodell sowie die gesamte Wertschöpfungskette widerspiegeln.
Eine Wesentlichkeitsanalyse hilft, prioritäre Biodiversitätsaspekte wie den Schutz von Wildtieren, die Reduzierung von Lebensraumverlust und den Umgang mit invasiven Arten zu identifizieren. Die festgelegten Biodiversitätsziele sollten mit der übergeordneten Nachhaltigkeits-, ESG- und Unternehmensstrategie harmonieren. Um diese Ziele zu messen, werden KPIs wie Ökosystemintegrität, Biodiversitätsverlust, Landdegradation und Wasserstress herangezogen.
Ein Beispiel liefert EcoTree mit einem Projekt in Norddänemark: Eine ehemalige Kiesgrube wurde in 31,2 Hektar Mischwald umgewandelt, der über die nächsten 100 Jahre 6.200 Tonnen CO₂e binden wird.
Unternehmen müssen interne Systeme entwickeln, die ESG-Daten zuverlässig erfassen und Wasser- sowie Biodiversitätsindikatoren in die Geschäftsplanung integrieren. Für die Wasserüberwachung sollten spezifische, kontextbezogene Ziele definiert und sowohl Wasserquantität als auch -qualität aktiv gemanagt werden.
Ein bemerkenswertes Beispiel liefert Elanco: Der Produktionsstandort in Clinton, Indiana, senkte den Grundwasserverbrauch zwischen 2008 und 2023 von 2,3 Milliarden Gallonen auf 0,98 Milliarden Gallonen – durch Maßnahmen wie Abwasserwiederverwendung und die Behebung von Leckagen.
„Wir verlassen uns auf reichlich vorhandenes, sauberes Wasser für verschiedene Prozesse – einschließlich Herstellung, Forschung und Entwicklung sowie landwirtschaftlicher Betriebe. Wasserknappheit und Wasserqualität sind weltweit wachsende Sorgen, mit zunehmender regulatorischer Kontrolle, Stakeholder-Erwartungen und potenziellen Auswirkungen auf die Geschäftskontinuität und den Ruf. Daher ist es für Elanco entscheidend, wasserbezogene Herausforderungen anzugehen, um die Nachhaltigkeit und Resilienz unserer Betriebe und Lieferketten sicherzustellen."
Die Verbindung zwischen der Messung von Biodiversität, Berichterstattung und einer überzeugenden Kommunikation ist entscheidend. Unternehmen benötigen Systeme, die sowohl regulatorische Anforderungen erfüllen als auch interne Entscheidungen unterstützen.
Nachdem Ziele und Überwachungsmechanismen definiert sind, ist die Einbindung aller relevanten Akteure der nächste Schritt. Die CSRD verändert die Unternehmensorganisation, da Finanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung zunehmend verschmelzen. Während Nachhaltigkeitsabteilungen oft die Hauptverantwortung tragen, spielen auch Buchhaltungs- und Finanzteams eine wichtige Rolle.
Multidisziplinäre Teams, bestehend aus Umwelt- und Nachhaltigkeitsexperten, Risikomanagern und externen Fachleuten, sollten frühzeitig eingebunden werden. Ein dedizierter ESG-Ausschuss kann helfen, ESG-Themen innerhalb der Organisation zu priorisieren.
Whitney Eaton, Executive Vice President of People and Sustainability bei TGS, erklärt:
„Wenn ich nach Nachhaltigkeitsfachkräften suche, um meine Organisation zu unterstützen, beginne ich immer zuerst intern."
Das Engagement von Stakeholdern sollte strukturiert und transparent ablaufen, mit einer klaren Trennung zwischen primären und sekundären Stakeholdern. Umfragen, Interviews, Workshops und Fokusgruppen können wertvolle Einblicke liefern. Besonders wichtig ist die Zusammenarbeit auf Einzugsgebietsebene, um Wasserrisiken und -chancen zu identifizieren. So unterstützte Elanco zwischen 2021 und 2023 die Wiederbepflanzung und Wiederherstellung von Graslandschaften in West-Kansas mit 150.000 US-Dollar.
Der Erfolg hängt auch von der Schulung der Teams ab, damit alle Mitarbeitenden die Konzepte und Risiken rund um den Biodiversitätsverlust verstehen. Führungskräfte spielen dabei eine zentrale Rolle, wie Gabriel Rolland, Vice President of Corporate QHSE bei TGS, betont:
„Es beginnt definitiv von oben."
Die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse müssen aktiv ins Risikomanagement einfließen, um Lieferketten, Produktionsprozesse und Standorte so zu gestalten, dass Risiken minimiert und Chancen besser genutzt werden.
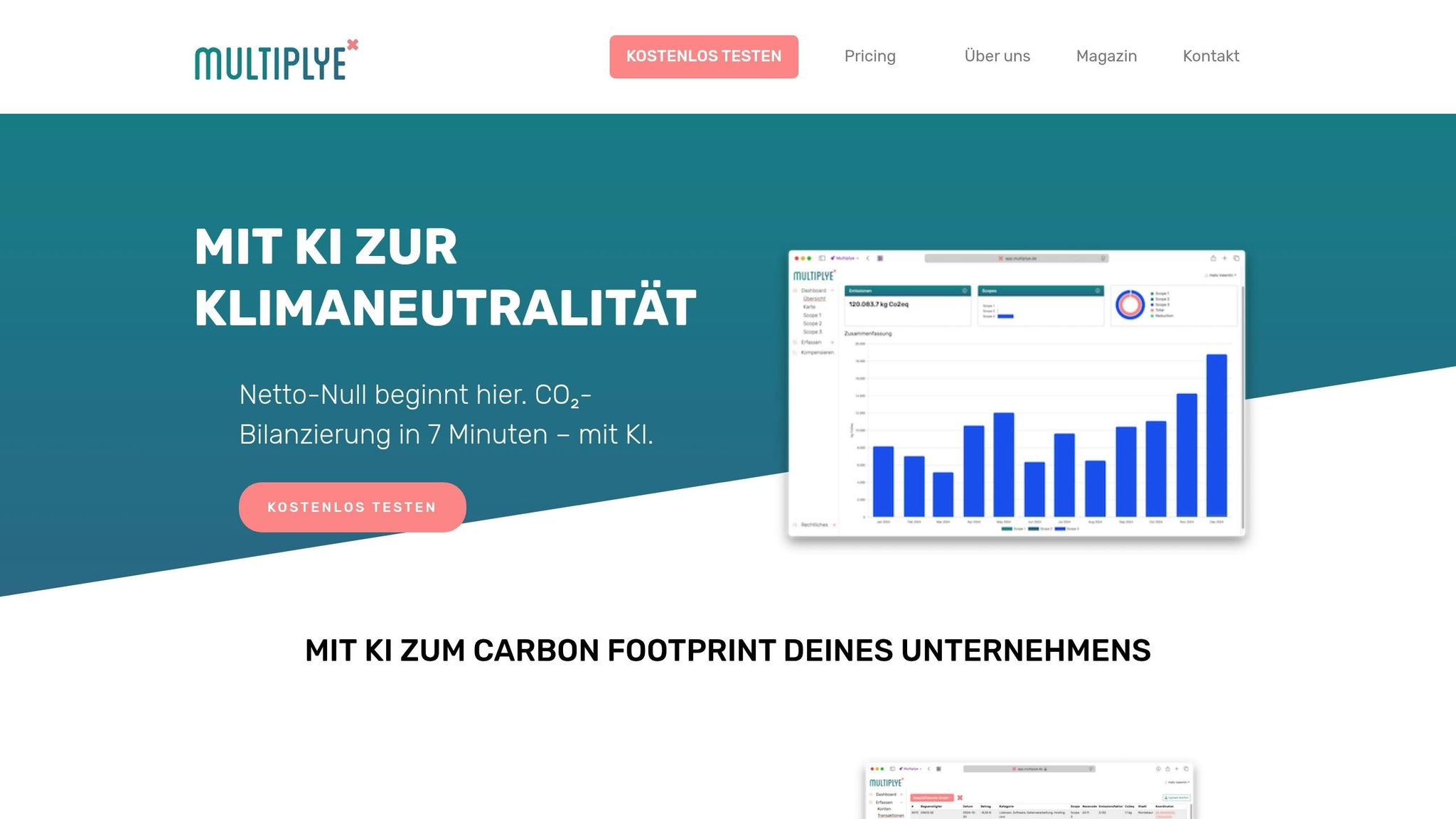
Deutsche Unternehmen stehen zunehmend vor der Aufgabe, komplexe Daten zu Wasser und Biodiversität systematisch zu erfassen und gemäß den Anforderungen der CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) zu berichten. Hier kommen digitale Plattformen wie MULTIPLYE ins Spiel, die den Prozess nicht nur vereinfachen, sondern auch die Qualität der Daten verbessern. Mit der CSRD wird der Bedarf an effizienten, automatisierten Lösungen immer dringlicher. Werfen wir einen Blick auf die Funktionen, mit denen MULTIPLYE diese Anforderungen adressiert.
MULTIPLYE bietet weit mehr als reine CO₂-Bilanzierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen dabei, Wasser- und Biodiversitätsrisiken in ihre Berichterstattung zu integrieren, und setzt dabei auf den Einsatz von KI. Diese analysiert Umweltdaten in kürzester Zeit und erstellt geographische Risikoübersichten.
Zusätzlich bietet die Plattform eine Expertenberatung, die speziell bei der Interpretation komplexer Biodiversitäts- und Wasserdaten unterstützt. Zukünftige Updates sollen CO₂-Reduzierungs-Empfehlungen und Benchmarking-Funktionen einführen, die auch Wasser- und Biodiversitätsaspekte berücksichtigen.
Die Funktionen von MULTIPLYE bringen greifbare Vorteile, insbesondere durch Zeitersparnis und Datensicherheit. So hilft die Plattform Unternehmen, die umfangreichen CSRD-Anforderungen effizient und ganzheitlich zu erfüllen.
Zeitersparnis ist ein zentraler Punkt: Während manuelle Prozesse Wochen oder sogar Monate in Anspruch nehmen können, liefert MULTIPLYE Ergebnisse innerhalb von Minuten. Dies ist besonders wertvoll angesichts der umfangreichen Berichtspflichten der CSRD.
Ein weiterer Vorteil liegt in der Prüfungssicherheit. Automatisierte Systeme identifizieren Datenlücken und Anomalien und schaffen einen zuverlässigen Prüfpfad, der den ESRS-Anforderungen (European Sustainability Reporting Standards) entspricht. Dank der maschinenlesbaren und leicht zugänglichen Daten wird die Einhaltung regulatorischer Vorgaben erleichtert. Alle Daten werden sicher in Deutschland gehostet, was zusätzliche Rechtssicherheit bietet.
Datenintegration ist ein weiteres Highlight. MULTIPLYE kombiniert Informationen aus Quellen wie dem Aqueduct Water Risk Atlas des World Resources Institute und dem Integrated Biodiversity Assessment Tool (IBAT). Diese nahtlose Integration ist besonders für Unternehmen in wasserintensiven Branchen hilfreich, um Risiken wie Wasserknappheit oder Überschwemmungen frühzeitig zu erkennen.
Ein entscheidender Punkt, vor allem für mittelständische Unternehmen, ist die Kosteneffizienz. MULTIPLYE bietet eine 7-tägige kostenlose Testphase und eine transparente Preisstruktur, die ab 1.999 € jährlich für die Premium-Version beginnt. Damit wird auch kleineren Unternehmen der Zugang zu professionellen Berichterstattungstools ermöglicht. Ein weiterer Vorteil: Die Datengrundlagen werden kontinuierlich aktualisiert, was besonders wichtig ist, um auf sich schnell ändernde Biodiversitätsrisiken reagieren zu können.
Die zuvor beschriebenen Anforderungen und Bewertungsmethoden zeigen deutlich, wie Unternehmen ihre Geschäftsresilienz stärken können: Die Einbindung von Wasser- und Biodiversitätsrisiken in die Nachhaltigkeitsstrategie ist ein entscheidender Schritt, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.
Die Zahlen sprechen für sich: Über 75 % der weltweiten Nahrungsmittelpflanzen sind auf Bestäuber angewiesen und leisten einen jährlichen Beitrag von 235–577 Milliarden US-Dollar zur globalen Agrarproduktion. Gleichzeitig stammen 75 % der weltweiten Süßwasserressourcen aus gesunden Ökosystemen. Diese Abhängigkeiten unterstreichen, warum Unternehmen nicht länger auf eine umfassende Berichterstattung über Umweltrisiken verzichten können, wenn sie ihre Geschäftskontinuität sichern wollen.
Für deutsche Unternehmen ergeben sich aus den CSRD-Anforderungen konkrete Maßnahmen, um ihre Nachhaltigkeitsstrategie zu verbessern:
Darüber hinaus ist es wichtig, klare und messbare Ziele auf Unternehmens- und Standortebene festzulegen. Robert Kammerer von PwC Deutschland bringt die Dringlichkeit auf den Punkt:
„Wasser – eine lebenswichtige natürliche Ressource, die nährende Umgebung für aquatische und marine Ökosysteme, ein regulierender Faktor für das Klima und ein fundamentales Menschenrecht – steht unter zunehmendem Druck. Jetzt ist die Zeit für Unternehmen gekommen, sich zu einem wasserresilienten Betriebsmodell zu transformieren."
Die Umsetzung dieser Maßnahmen bringt sowohl betriebliche als auch finanzielle Vorteile mit sich:
Angesichts der Tatsache, dass der jährliche wirtschaftliche Schaden durch den Verlust der Biodiversität auf 10 Billionen US-Dollar geschätzt wird, wird deutlich, wie wichtig ein proaktives Risikomanagement ist.
Deutsche Unternehmen, die Wasser- und Biodiversitätsrisiken in ihre CSRD-Berichterstattung integrieren, sichern nicht nur die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Sie schaffen auch die Grundlage für eine widerstandsfähige Zukunft in einer Welt, die zunehmend von Klimawandel und Ressourcenknappheit geprägt ist.
Um den Anforderungen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in Bezug auf Wasser- und Biodiversitätsrisiken gerecht zu werden, können Unternehmen gezielte Maßnahmen umsetzen:
Mit diesen Maßnahmen können Unternehmen nicht nur die CSRD-Vorgaben einhalten, sondern auch ihre langfristige Stabilität und Umweltverantwortung stärken.
Die Berücksichtigung von Wasser- und Biodiversitätsrisiken in der Unternehmensstrategie ist ein entscheidender Schritt, um auf lange Sicht wettbewerbsfähig zu bleiben. Durch gezielte Maßnahmen können Unternehmen operative und regulatorische Risiken verringern, die beispielsweise durch Wasserknappheit oder den Verlust von Artenvielfalt entstehen. Gleichzeitig lassen sich Kosten senken, etwa durch einen effizienteren Einsatz von Ressourcen und die Einführung nachhaltiger Verfahren.
Unternehmen, die aktiv mit Biodiversität und Wasserressourcen umgehen, sichern sich nicht nur einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz, sondern stärken auch ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Umweltveränderungen. Darüber hinaus fördert ein verantwortungsvoller Umgang mit diesen Themen das Vertrauen der Öffentlichkeit und verbessert die gesellschaftliche Akzeptanz – ein entscheidender Faktor für nachhaltigen Erfolg.
Unternehmen haben die Möglichkeit, digitale Tools zu nutzen, um Risiken in den Bereichen Wasser und Biodiversität gezielt zu analysieren und diese in ihre Berichterstattung gemäß der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) einzubinden.
Ein hilfreiches Werkzeug ist der Aqueduct Water Risk Atlas, der wasserbezogene Risiken auf regionaler Ebene bewertet. Dieses Tool unterstützt dabei, potenzielle Gefährdungen besser zu erkennen und einzuordnen. Der WWF Water Risk Filter geht noch einen Schritt weiter und analysiert physische, regulatorische sowie reputationsbezogene Wasserrisiken. Für Biodiversitätsfragen bietet sich das EY Nature Analytics Tool (EY NAT) an. Es hilft Unternehmen, Risiken und Chancen im Bereich Biodiversität zu identifizieren und nachhaltige Managementstrategien zu entwickeln.
Mit diesen Tools können Unternehmen nicht nur die CSRD-Anforderungen erfüllen, sondern auch ihre Widerstandsfähigkeit stärken und nachhaltige Geschäftspraktiken fördern.