Melde dich jetzt für die Warteliste an.
Für Warteliste anmelden
Für Warteliste anmelden

Sie haben Ihre THG-Bilanz erstellt – was nun? Der nächste Schritt ist klar: Wechseln Sie auf erneuerbare Energien und nutzen Sie Herkunftsnachweise, um dies rechtlich nachzuweisen und Ihre Klimaziele zu erreichen.
Die Energiewende ist nicht nur eine Verpflichtung, sondern auch ein Wettbewerbsvorteil. Jetzt handeln und nachhaltiger werden!
Herkunftsnachweise spielen eine zentrale Rolle in der Klimaberichterstattung. Sie verbinden eine transparente Treibhausgasbilanz (THG-Bilanz) mit echten Fortschritten bei der Reduzierung von Emissionen. Doch was genau steckt hinter diesen digitalen Zertifikaten?
Herkunftsnachweise (auf Englisch: Guarantees of Origin, GOs) sind digitale Dokumente, die den Ursprung von erneuerbarer Energie belegen. Das Prinzip dahinter ist einfach: Für jede erzeugte und ins Netz eingespeiste Einheit erneuerbarer Energie wird ein Zertifikat ausgestellt.
Diese Zertifikate sind einzigartig und können nicht mehrfach verwendet werden, was den mehrfachen Verkauf derselben Energie ausschließt. Energieversorger nutzen sie, um nachzuweisen, dass sie erneuerbare Energie geliefert haben.
Interessant ist, dass die Nachfrage nach Herkunftsnachweisen die Anzahl der ausgestellten Zertifikate übersteigt. Das zeigt, wie wichtig sie für den Markt sind. Diese Grundlagen bilden die Basis für die gesetzlichen Regelungen in Deutschland.
In Deutschland gibt es klare Vorgaben für den Umgang mit Herkunftsnachweisen. Seit dem 1. Januar 2013 dürfen Stromversorger erneuerbare Energie nur dann in Rechnungen oder Werbematerialien angeben, wenn sie die entsprechenden Zertifikate im Herkunftsnachweisregister (HKNR) entwertet haben.
Das Umweltbundesamt (UBA) ist dafür zuständig, die Verlässlichkeit und Richtigkeit dieser Nachweise sicherzustellen. Rechtsgrundlagen sind § 79 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2021) sowie die Erneuerbare-Energien-Verordnung (EEV) vom 17. Februar 2015.
Besonders bemerkenswert ist die Regelung für nicht-EEG-geförderte Anlagen: Betreiber von erneuerbaren Energieanlagen, die ihren Strom direkt vermarkten und keine EEG-Vergütung erhalten, können Herkunftsnachweise für ihren eingespeisten Strom beantragen. Diese Zertifikate lassen sich frei verkaufen, etwa um Börsenstrom als „grüne Energie“ zu kennzeichnen.
Diese gesetzlichen Regelungen machen Herkunftsnachweise zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Unternehmen, die ihre nachhaltige Energieversorgung belegen möchten.
Herkunftsnachweise sind der einzige anerkannte Mechanismus, mit dem Verbraucher glaubwürdig nachweisen können, dass sie erneuerbare Energie nutzen. Sie ergänzen die THG-Bilanz und ermöglichen eine zuverlässige Darstellung nachhaltiger Energieverwendung. Für Unternehmen ergeben sich daraus mehrere Vorteile:
Ein weiterer Aspekt ist die Strompreiskompensation: Unternehmen, die an entsprechenden Programmen teilnehmen möchten, müssen oft Herkunftsnachweise vorlegen, die zeitlich und geografisch genau zugeordnet sind. Das zeigt, wie wichtig es ist, diese Zertifikate strategisch in die Geschäftspraxis zu integrieren.
Die vielfältigen Vorteile von Herkunftsnachweisen machen sie zu einem zentralen Instrument für Unternehmen, die ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen und dokumentieren möchten.
Der Erwerb von Herkunftsnachweisen ist ein wichtiger Schritt für Unternehmen, die ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen und gesetzliche Anforderungen erfüllen möchten. Die Umsetzung erfordert jedoch eine gut durchdachte und strukturierte Herangehensweise.
Der Prozess beginnt mit der Registrierung im Herkunftsnachweisregister (HKNR). Dafür müssen Unternehmen ihre Stammdaten angeben, einen Identitätsnachweis (z. B. PostIdent-Verfahren oder eine Kopie des Reisepasses) sowie einen Handelsregisterauszug einreichen. Es ist dabei wichtig zu beachten, dass für die Nutzung des Registers Gebühren anfallen können.
Bei der Auswahl der Zertifikate spielen verschiedene Kriterien eine Rolle: die Herkunft der Energie, die eingesetzte Technologie (z. B. Solar, Wind, Wasserkraft oder Biomasse), der Erzeugungszeitraum sowie das Alter der Anlagen. Diese Faktoren beeinflussen nicht nur die Kosten, sondern auch die Glaubwürdigkeit der Nachhaltigkeitsberichterstattung.
Die Beschaffungsstrategie sollte sich an den Vorgaben des GHG Protocol und den Richtlinien des CDP orientieren. Eine Zusammenarbeit mit anerkannten EKOenergy-Anbietern kann dabei helfen, zusätzliche ökologische Kriterien zu erfüllen.
Nach dem Kauf müssen die Herkunftsnachweise im Register „entwertet“ oder „stillgelegt“ werden, um sicherzustellen, dass sie nicht doppelt verwendet werden. Dieser Schritt ist entscheidend, um die Nachweise effektiv in Ihre Energiestrategie einzubinden.
„Guarantees of origin (GO) prove the origin of renewable energy in a transparent way and provide electricity consumers the necessary reliability." - Umweltbundesamt
Nach dem Erwerb der Herkunftsnachweise ist es wichtig, diese strategisch in die Energiestrategie des Unternehmens einzubinden. Basierend auf der Treibhausgasbilanz (THG-Bilanz) können Unternehmen gezielt erneuerbare Energien nachfragen, was wiederum den Ausbau regenerativer Kapazitäten fördert. Diese marktbasierte Herangehensweise motiviert Energieversorger dazu, mehr grüne Stromprodukte anzubieten und in den Ausbau erneuerbarer Energien zu investieren. Langfristige Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements, PPAs) mit Betreibern erneuerbarer Anlagen profitieren ebenfalls von diesem Ansatz.
Darüber hinaus ermöglichen Herkunftsnachweise die Reduktion von Scope-2-Emissionen, indem sie den Wechsel zu erneuerbaren Energien dokumentieren. Auch entlang der Wertschöpfungskette können positive Effekte auf Scope-3-Emissionen erzielt werden, insbesondere durch die Zusammenarbeit mit Lieferanten. Die Auswahl unterschiedlicher Technologien wie Geothermie oder Bioenergie bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Nachhaltigkeitsstrategie gezielt anzupassen.
Für die Treibhausgasbilanzierung nach internationalen Standards sind Herkunftsnachweise unverzichtbar. Sie belegen den Einsatz erneuerbarer Energien und dokumentieren konkrete Emissionsreduktionen. Innerhalb Europas unterstützen sie die Einhaltung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (REDII) und tragen zu einer besseren Bewertung der Nachhaltigkeitsleistung bei.
Die grenzüberschreitende Beschaffung erneuerbarer Energien in über 25 Ländern des europäischen Binnenmarktes bietet ein hohes Maß an Transparenz. Durch die Rückverfolgbarkeit der Stromherkunft können emissionsbezogene Angaben technologiespezifisch dargestellt werden, was die Glaubwürdigkeit von Nachhaltigkeitsberichten zusätzlich stärkt.
Für eine erfolgreiche Umsetzung sollten Unternehmen sicherstellen, dass die Herkunftsnachweise zeitlich und geografisch mit ihrem Energieverbrauch übereinstimmen. Diese präzise Dokumentation stärkt die nachhaltige Strategie und bildet die Grundlage für weiterführende Maßnahmen.
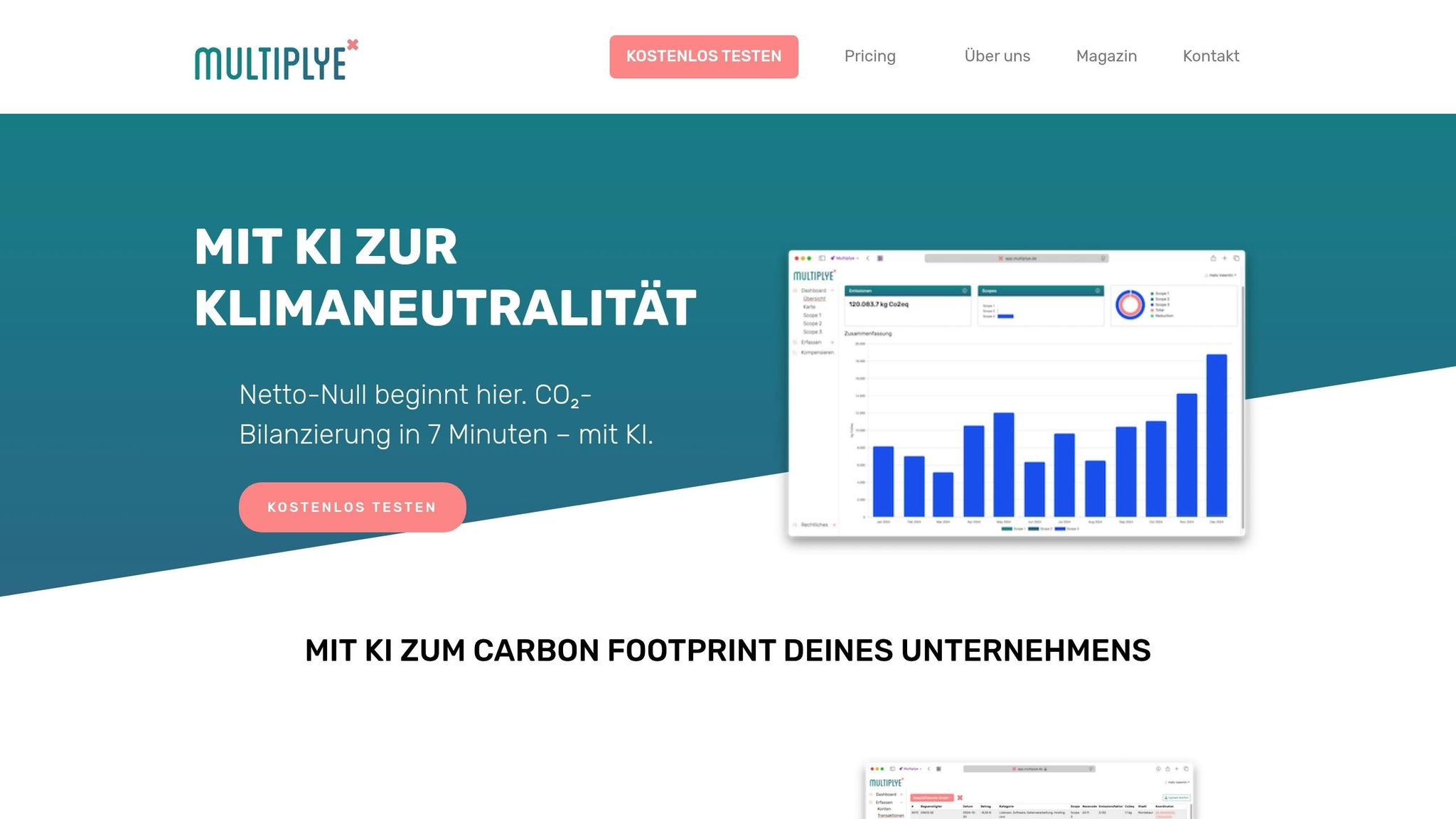
MULTIPLYE bietet eine praktische Lösung, um CO₂-Bilanzierung und die Dokumentation von Herkunftsnachweisen miteinander zu verbinden. Die Plattform ermöglicht deutschen Unternehmen eine automatisierte und übersichtliche Nachhaltigkeitsberichterstattung, die den gesamten Prozess deutlich einfacher gestaltet.
Mit MULTIPLYE wird die CO₂-Berechnung nach dem GHG Protocol automatisiert, unterstützt durch KI-Analysen, die gezielt Reduktionspotenziale aufzeigen. Die Plattform erfüllt alle relevanten EU-Vorgaben und speichert Daten sicher in Deutschland – ein klarer Pluspunkt in Sachen Datenschutz und Compliance. Dank der KI-gestützten Auswertung können CO₂e-Werte präzise nach Scope-Kategorien erfasst und rückwirkend analysiert werden.
Ein weiteres Highlight ist die geografische Übersicht der Geschäftsverbindungen, die wertvolle Einblicke für die Bewertung von Klimarisiken liefert. Für Nutzer der Premium-Version gibt es zusätzlich eine interaktive Heatmap zur CO₂e-Bilanz sowie persönliche Beratung durch Experten im Bereich Nachhaltigkeit. Diese Kombination bietet eine solide Basis, um strategische Entscheidungen zur Emissionsminderung zu treffen.
Diese Funktionen sind auch der Schlüssel zu einer effizienten Verwaltung von Herkunftsnachweisen, die im nächsten Abschnitt näher beleuchtet wird.
Neben der CO₂-Bilanzierung erleichtert MULTIPLYE auch die Verwaltung von Herkunftsnachweisen. Die Plattform integriert diese Nachweise reibungslos in die Berichterstattung und erfüllt dabei alle gesetzlichen Anforderungen.
MULTIPLYE ermöglicht es Unternehmen, Guarantees of Origin (GoOs) strukturiert zu erfassen und zu verwalten. Diese Nachweise belegen, dass der genutzte Strom aus erneuerbaren Quellen stammt. Gleichzeitig hilft die Plattform, regulatorische Änderungen im Blick zu behalten, während die Bundesnetzagentur (BNetzA) als zentrale Regulierungsstelle die Entwicklung erneuerbarer Energien überwacht.
Durch die Einbindung von Herkunftsnachweisen in die CO₂-Bilanzierung können Unternehmen ihre Scope-2-Emissionen senken und dokumentieren. Darüber hinaus unterstützt MULTIPLYE die zeitliche und geografische Zuordnung erneuerbarer Energien zum tatsächlichen Verbrauch – ein Ansatz, der immer mehr an Bedeutung gewinnt.
Der Wechsel zu erneuerbaren Energien auf Basis der THG-Bilanz erfordert eine gut durchdachte Strategie. Mit einer klaren Vorgehensweise können Unternehmen sowohl ihre Klimaziele erreichen als auch regulatorische Vorgaben einhalten. Doch wie sieht der Prozess aus, um grüne Energie effektiv in Ihre CO₂-Berichterstattung zu integrieren?
Herkunftsnachweise beschaffen – das ist der erste Schritt. Unternehmen sollten Herkunftsnachweise erwerben, die exakt ihrem Stromverbrauch entsprechen. Dabei sind vier Punkte entscheidend: Mengentreue, Regionalität, Gleichzeitigkeit und Zusätzlichkeit. Diese Faktoren stellen sicher, dass der tatsächliche Stromverbrauch korrekt abgebildet wird. Die Kosten für Herkunftsnachweise liegen im Durchschnitt bei etwa 8,00 EUR pro Megawattstunde (0,8 Cent pro Kilowattstunde), wobei die Preise je nach Erzeugungstechnologie und Herkunftsregion schwanken. Nach der Beschaffung folgt ein ebenso wichtiger Schritt: die Integration in die CO₂-Berichterstattung.
Die Einbindung in Ihre Klimabilanz sollte präzise erfolgen, insbesondere in die Scope-2-Emissionen. Hierbei ist es wichtig, anerkannte Zertifizierungsstandards wie TÜV Nord 1304 oder TÜV Süd EE01/EE02 zu berücksichtigen. Diese Standards bieten nicht nur Orientierung, sondern ermöglichen es Ihnen auch, Ihre Nachhaltigkeitsmaßnahmen extern überprüfen und validieren zu lassen. Angesichts des steigenden Bedarfs an grünem Strom schaffen solche Standards eine solide Grundlage.
Die Nachfrage nach grünem Strom in Deutschland wird bis 2030 voraussichtlich um 168,5 % zunehmen. Unternehmen, die frühzeitig handeln, können sich Wettbewerbsvorteile sichern und sind besser auf strengere Regulierungen vorbereitet. Ein Beispiel: Rechenzentren sind ab dem 1. Januar 2024 verpflichtet, mindestens 50 % ihres Stroms aus unsubventionierten erneuerbaren Quellen zu beziehen. Ab 2027 steigt dieser Anteil auf 100 %.
Um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, bietet MULTIPLYE eine automatisierte Lösung an. Diese Plattform übernimmt die Verwaltung und Zuordnung von Herkunftsnachweisen, sodass Sie sich auf die strategische Umsetzung konzentrieren können.
Ein weiterer wichtiger Punkt: Überprüfen Sie regelmäßig, ob Ihre Herkunftsnachweise mit Ihrer THG-Bilanz übereinstimmen. Nur so können Sie sicherstellen, dass Sie langfristig Ihre Klimaziele erreichen und auf dem richtigen Kurs bleiben.
Herkunftsnachweise (HKN) sind eine praktische und transparente Möglichkeit für Unternehmen, nachzuweisen, dass ihr Strom aus erneuerbaren Energien stammt. Damit lässt sich der CO₂-Fußabdruck – insbesondere die Scope-2-Emissionen – reduzieren. Das wirkt sich nicht nur positiv auf die Umwelt aus, sondern stärkt auch das nachhaltige Image und die Glaubwürdigkeit des Unternehmens. Gleichzeitig können gesetzliche Vorgaben leichter erfüllt werden.
Ein weiterer Vorteil: HKN sind oft eine kostengünstige Option, um Emissionen schnell zu senken, ohne dass Unternehmen in eigene erneuerbare Energiequellen investieren müssen. Sie helfen dabei, Dekarbonisierungsziele zu erreichen und sich gegenüber Kunden und Stakeholdern als umweltbewusst und zukunftsorientiert zu präsentieren.
Das Umweltbundesamt ist für die Entwertung von Herkunftsnachweisen im Herkunftsnachweisregister (HKNR) verantwortlich. Diese Entwertung betrifft vor allem Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU), die Strom an Endverbraucher liefern. Sobald die Nachweise entwertet sind, können sie weder weiterverkauft noch erneut verwendet werden.
Dieser Prozess spielt eine zentrale Rolle, um sicherzustellen, dass der als erneuerbar deklarierte Strom tatsächlich aus erneuerbaren Energiequellen stammt. Außerdem verhindert die Entwertung eine mögliche Doppelvermarktung der Nachweise. Das schafft nicht nur Transparenz, sondern gibt Verbrauchern auch die Sicherheit, dass sie echten Ökostrom beziehen. So wird die Nutzung erneuerbarer Energien glaubwürdig und nachvollziehbar.
Wenn es um Herkunftsnachweise geht, gibt es einige wichtige Aspekte, die Unternehmen berücksichtigen sollten, um sicherzustellen, dass ihre Entscheidungen sowohl ökologisch sinnvoll als auch glaubwürdig sind:
Die Auswahl der richtigen Herkunftsnachweise kann nicht nur Ihre Nachhaltigkeitsstrategie stärken, sondern auch aktiv zur Energiewende beitragen.