Melde dich jetzt für die Warteliste an.
Für Warteliste anmelden
Für Warteliste anmelden

Return Periods, oder Wiederkehrperioden, bewerten, wie oft ein bestimmtes Ereignis – wie Hochwasser oder extreme Wetterereignisse – durchschnittlich auftritt. Sie sind entscheidend für Unternehmen, um Risiken zu analysieren und Klimaschäden zu minimieren. Besonders in Deutschland, wo Wetterextreme zwischen 2000 und 2021 Schäden von über 145 Milliarden Euro verursachten, sind sie unverzichtbar.
Ein Hochwasser mit einer 10-jährigen Wiederkehrperiode hat jedes Jahr eine Wahrscheinlichkeit von 10 %. Unternehmen können diese Daten nutzen, um Schutzmaßnahmen zu planen und Schäden zu minimieren.
MULTIPLYE integriert Return Periods, um Unternehmen bei der CO₂-Bilanzierung, Risikomessung und Einhaltung von Klimazielen zu unterstützen. Automatisierte Analysen sparen Zeit und erhöhen die Genauigkeit.
Die Berechnung von Wiederkehrperioden basiert auf statistischen Wahrscheinlichkeiten. Die Grundformel lautet: T = 1/P, wobei T die Wiederkehrperiode und P die jährliche Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses darstellt.
Ein einfaches Beispiel: Ein Hochwasser mit einer Wiederkehrperiode von 10 Jahren hat eine Wahrscheinlichkeit von 1/10 = 0,1 bzw. 10 %, in einem beliebigen Jahr aufzutreten. Ein 50-Jahres-Hochwasser hat entsprechend eine Wahrscheinlichkeit von 0,02 oder 2 %.
Häufig nutzen Experten historische Daten und die Weibull-Formel, um Wiederkehrperioden zu berechnen:
Wiederkehrintervall = (n+1)/m,
wobei n die Anzahl der Jahre mit verfügbaren Aufzeichnungen und m der Rang des beobachteten Ereignisses in absteigender Reihenfolge ist.
Die folgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Wiederkehrperioden und Wahrscheinlichkeiten:
| Wiederkehrperiode (Jahre) | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahrscheinlichkeit (%) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 33 | 50 | 100 |
Für komplexere Risikoszenarien, wie sie in der Geschäftswelt auftreten, ist die Poisson-Verteilung besonders relevant. Sie modelliert die Wahrscheinlichkeit mehrerer Ereignisse über einen längeren Zeitraum. Die Formel lautet:
P(r;t) = ((t/T)^r / r!) · e^(–t/T),
wobei t die betrachtete Zeitspanne, T die Wiederkehrperiode und r die Anzahl der Ereignisse ist. Diese Methode ermöglicht eine präzisere Bewertung von Geschäftsrisiken.
Wiederkehrperioden sind ein unverzichtbares Werkzeug, um Risiken zu bewerten und fundierte Entscheidungen zu treffen. Unternehmen nutzen sie, um abzuschätzen, ob Projekte in risikoreichen Gebieten realisiert werden sollten oder wie Bauwerke dimensioniert werden müssen, um extremen Ereignissen standzuhalten.
Ein anschauliches Beispiel: Im Juli 2021 traf eine schwere Flutkatastrophe Deutschland, Belgien und Luxemburg. Mit Niederschlagsintensitäten von über 150 mm/h überschritt sie das 100-Jahres-Wiederkehrniveau deutlich. Solche Ereignisse verdeutlichen, wie Wiederkehrperioden helfen, extreme Wetterereignisse einzuschätzen.
„Die Zunahme extremer Niederschläge mit der globalen Erwärmung und die damit verbundenen Unsicherheiten sind große Herausforderungen für die Klimaanpassung.“
– Marie Hundhausen, Karlsruher Institut für Technologie
Für deutsche Unternehmen spielen regionale Faktoren wie klimatische Bedingungen, Bodenfeuchtigkeit und Niederschlagsmuster eine wichtige Rolle bei der Berechnung von Hochwasser-Wiederkehrperioden. Das Regional Flood Model (RFM) für Deutschland simulierte beispielsweise einen Katalog von Hochwasserereignissen über 5.000 Jahre für die wichtigsten Einzugsgebiete.
Die Ergebnisse der Analyse sind beeindruckend: Der erwartete jährliche Schaden (Expected Annual Damage) für Deutschland wurde auf 0,529 Milliarden Euro geschätzt, wobei der Handelssektor etwa 60 % des Gesamtrisikos trägt. Der Value at Risk bei einer Konfidenz von 99,5 % liegt bei 8,865 Milliarden Euro.
Eine wichtige Gleichung zur Risikobewertung lautet:
R = 1 – (1 – 1/T)^n,
wobei n die Lebensdauer einer Struktur darstellt. Diese Formel hilft Unternehmen, das Risiko über die gesamte Nutzungsdauer von Anlagen oder Infrastrukturen zu bewerten.
Deutsche Unternehmen sollten bei der Verwendung von Wiederkehrperioden stets spezifische Parameter angeben, wie z. B. die Region, die Art der Gefahr und den zu bewertenden Wert. Es ist entscheidend zu verstehen, dass eine Wiederkehrperiode nicht bedeutet, dass ein Ereignis regelmäßig alle T Jahre auftritt. Ebenso wenig schließt ein bereits eingetretenes Ereignis aus, dass es in den nächsten T Jahren erneut geschieht.
„Wiederkehrperioden können zur Risikobewertung von extremen Niederschlägen, Sturmfluten und Hochwasser verwendet werden, aber nicht für den zukünftigen Meeresspiegelanstieg auf globaler Ebene.“
– Efthymia Koliokosta, University of West Attica
Für eine effektive Anwendung sollten deutsche Unternehmen empirische Modelle nutzen, die speziell für Deutschland kalibriert wurden. Dabei ist es wichtig, Unsicherheiten in Daten und Modellen sowie die räumliche Abhängigkeit zwischen Extremereignissen zu berücksichtigen. Nur so können Entscheidungen fundiert getroffen werden.
Return Periods bringen eine neue Ebene der Genauigkeit in die CO2-Bilanzierung. Anders als herkömmliche Ansätze, die oft nur Momentaufnahmen liefern, betrachten sie Emissionsmuster über längere Zeiträume. Das macht es möglich, Emissionen nicht nur zu messen, sondern auch besser zu verstehen.
Durch diese Methode lassen sich Baseline-Emissionen validieren und realistische Reduktionsziele setzen. Mit einer Analyse, die auf Wiederkehrperioden basiert, können Unternehmen in ihren Lieferketten gezielt Bereiche identifizieren, in denen Emissionen reduziert werden können – sei es durch den Wechsel zu emissionsärmeren Lieferanten oder durch den Einsatz alternativer Materialien.
Ein Beispiel: Wenn ein Unternehmen feststellt, dass seine Scope-3-Emissionen in bestimmten Zeiträumen über dem Durchschnitt liegen – und Scope-3-Emissionen können in einigen Branchen bis zu 90 % der Gesamtemissionen ausmachen – können gezielte Maßnahmen entwickelt werden.
Darüber hinaus ermöglichen Return Periods präzise Simulationen von Reduktionsstrategien. Mithilfe digitaler Modelle können verschiedene Szenarien durchgespielt werden, um die effektivsten Maßnahmen zu ermitteln. Diese Methode wird immer wichtiger, da sie den strenger werdenden Vorgaben in Deutschland und der EU entspricht.
Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) macht Return Periods zu einem unverzichtbaren Werkzeug für deutsche Unternehmen. Ab 2025 sind etwa 11.700 der größten börsennotierten Unternehmen, Banken und Versicherer in Europa verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen zu melden. Langfristig wird die CSRD auf fast 50.000 Unternehmen in Europa sowie auf über 10.000 Nicht-EU-Unternehmen und deren europäische Tochtergesellschaften ausgeweitet.
Das Bundes-Klimaschutzgesetz in Deutschland setzt jährliche CO2-Emissionsbudgets für verschiedene Sektoren fest. Return Periods helfen dabei, Strategien zu überwachen und anzupassen, um diese Ziele zu erreichen. Deutschland hat sich ehrgeizige Ziele gesteckt: Bis 2030 sollen die Emissionen um mindestens 65 %, bis 2040 um 88 % im Vergleich zu 1990 gesenkt werden. Bis 2045 soll das Land klimaneutral sein.
Das EU-Emissionshandelssystem (EU ETS) deckt rund 40 % der EU-Gesamtemissionen ab und hat zwischen 2005 und 2023 zu einer Reduktion der Emissionen in den erfassten Sektoren um etwa 47 % geführt. Unternehmen, die mehr CO₂ ausstoßen, als ihre Zertifikate abdecken, müssen 100 Euro pro überschüssiger Tonne zahlen. Ab 2027 wird das EU ETS II eingeführt, das den Kraftstoffsektor im Straßenverkehr und bei Gebäuden umfasst und eine noch genauere Emissionsberichterstattung verlangt.
Das nationale Emissionshandelssystem (nETS) in Deutschland ergänzt das EU ETS, indem es Kraftstoffemissionen abdeckt, die nicht im EU ETS erfasst sind. Die Preise sind bis 2025 fixiert (45 Euro in 2024 und 55 Euro in 2025). Ab 2026 wird ein Preiskorridor zwischen 55 und 65 Euro pro Tonne CO₂ eingeführt.
Der EU-Grenzausgleichsmechanismus für CO₂ (CBAM), der 2026 in Kraft tritt, betrifft zunächst Importe von Zement, Eisen und Stahl, Aluminium, Düngemitteln, Strom und Wasserstoff. Return Periods können Unternehmen helfen, Preisschwankungen besser einzuschätzen, da CBAM-Zertifikate auf Basis des wöchentlichen Durchschnitts der EU ETS-Auktionspreise berechnet werden.
„Der EU-Grenzausgleichsmechanismus für CO₂ (CBAM) ist das Instrument der EU, um einen fairen Preis für das bei der Produktion kohlenstoffintensiver Waren, die in die EU eingeführt werden, emittierte CO₂ zu setzen und eine sauberere Industrieproduktion in Nicht-EU-Ländern zu fördern." – European Commission
Für deutsche Unternehmen ist es ratsam, ihre CO₂-Bilanzierungsprozesse bereits jetzt zu testen, um optimal auf die neuen Vorgaben vorbereitet zu sein. Die Integration von Return Periods in diese Prozesse wird dabei eine zentrale Rolle spielen, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.
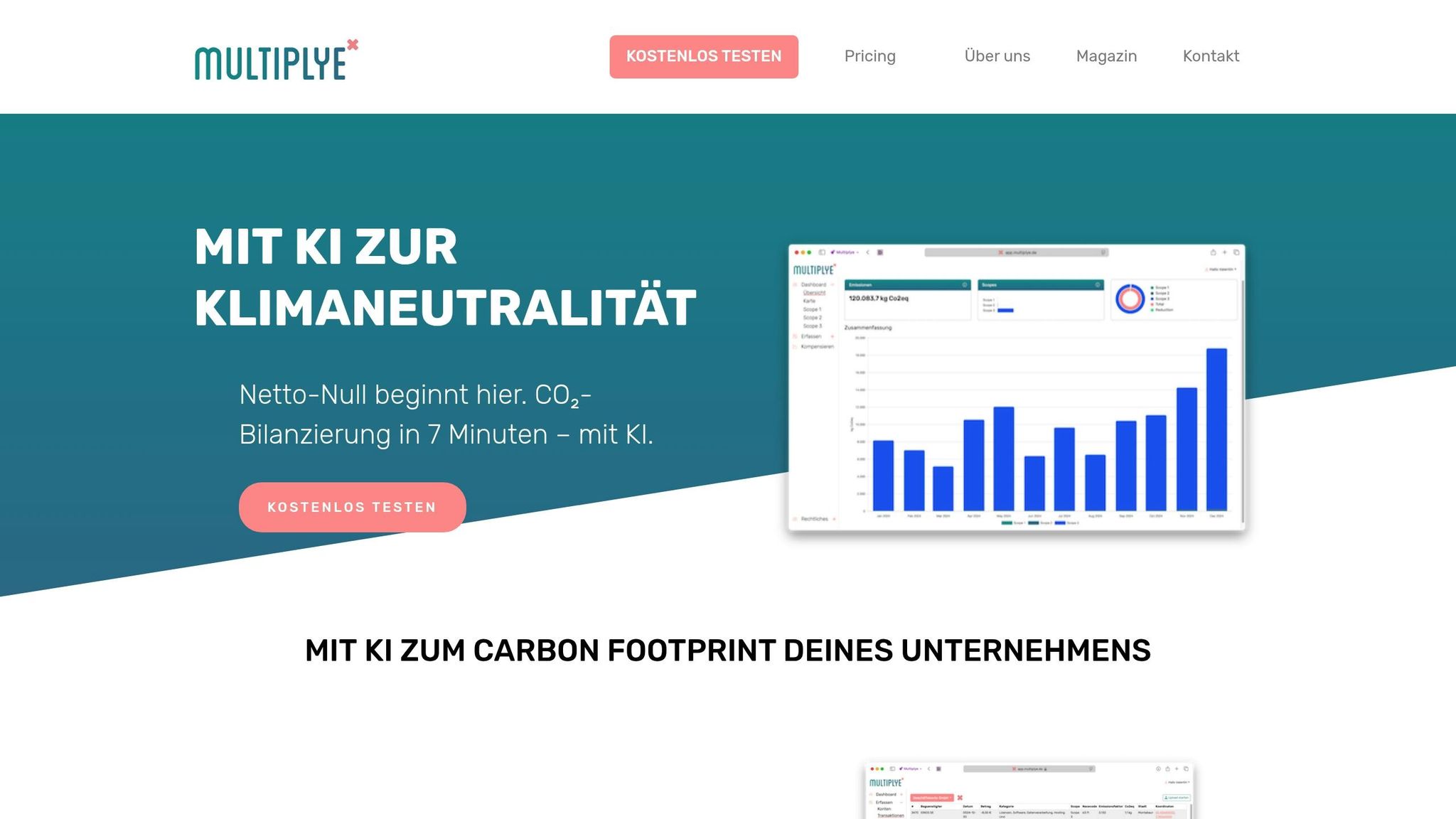
Die Bedeutung von Return Periods in der CO₂-Bilanzierung wird von MULTIPLYE gezielt genutzt, um detaillierte Analysen zu ermöglichen. Mithilfe der KI-gestützten Plattform analysiert MULTIPLYE historische Emissionsdaten, um langfristige Muster zu erkennen. Diese Erkenntnisse werden visuell aufbereitet, sodass Unternehmen fundierte Entscheidungen für ihre Nachhaltigkeitsstrategien treffen können. Eine geografische Übersicht der Geschäftsverbindungen unterstützt darüber hinaus die Bewertung spezifischer Risiken.
Durch die Kombination historischer Daten mit KI bietet MULTIPLYE eine präzise Berechnung von CO₂e-Emissionen. Die Integration von Return Periods ermöglicht es, zukünftige Entwicklungen besser einzuschätzen und gezielte Maßnahmen für die Reduktion von Emissionen zu planen.
Die Nutzung von Return Periods in der MULTIPLYE-Plattform bringt deutschen Unternehmen klare Vorteile für ihre Nachhaltigkeitsziele. Automatisierte Analysen helfen dabei, Emissionsmuster schneller und genauer zu erfassen, was eine effizientere CO₂-Bilanzierung unterstützt. Mit sicherem Hosting in Deutschland und CSRD-konformen Analysen erfüllt die Plattform die ab 2025 geltenden strengen Anforderungen.
Expert:innen von MULTIPLYE übersetzen die Analyseergebnisse in konkrete Handlungsempfehlungen. Zusätzlich arbeitet die Plattform an Features wie automatisierten Vorschlägen zur Emissionsreduktion und einem Benchmarking-Tool, mit dem Unternehmen ihre Emissionswerte mit Branchenstandards vergleichen können.
Um die steigenden Anforderungen an Compliance zu bewältigen, bietet MULTIPLYE einen Vergleich zwischen automatisierten und manuellen Analysen. Automatisierte Prozesse haben eine Fehlerrate von nur 2–5 %, während manuelle Ansätze bei 12–15 % liegen. Zudem senkt die Automatisierung den Zeitaufwand und die Arbeitsbelastung erheblich – eine Reduktion um etwa 78–79 %. Angesichts der wachsenden regulatorischen Anforderungen wird der Einsatz solcher Technologien für deutsche Unternehmen zunehmend zu einer strategischen Priorität.
Eine 7-tägige Testphase erlaubt es Unternehmen, die automatisierte Integration unverbindlich auszuprobieren und deren Vorteile direkt zu erleben.
Basierend auf den beschriebenen Berechnungsmethoden und Anwendungsfeldern werfen wir nun einen Blick auf konkrete Beispiele, wie deutsche Unternehmen Return Period-Daten für ihr Risikomanagement nutzen können.
Return Period-Daten bieten eine solide Grundlage, um Klimarisiken und deren mögliche Auswirkungen auf Unternehmen zu bewerten. Ein anschauliches Beispiel ist die quantitative Analyse von Überschwemmungsrisiken: Hierbei wurde ein potenzieller Schaden von 0,529 Milliarden Euro ermittelt – eine Zahl, die die Bedeutung solcher Risiken im Handelssektor verdeutlicht.
Mit Hilfe von MULTIPLYE können historische Klimadaten genutzt werden, um Wahrscheinlichkeiten extremer Wetterereignisse zu berechnen. Die Plattform wandelt diese Daten in geografische Risikoübersichten um, die gezielt Gefährdungen für Standorte und Lieferketten sichtbar machen.
Besonders bei Investitionsentscheidungen erweist sich diese Methode als hilfreich. Wenn ein Produktionsstandort in einer Region mit hohem Hochwasserrisiko liegt, können Return Period-Analysen dabei unterstützen, den richtigen Zeitpunkt für Schutzmaßnahmen zu bestimmen. MULTIPLYE liefert dabei nicht nur Daten, sondern auch konkrete Handlungsempfehlungen, die Unternehmen in ihre Nachhaltigkeitsstrategien integrieren können.
Darüber hinaus helfen diese Analysen, physische Risiken durch extreme Wetterereignisse besser einzuschätzen. Unternehmen können so nicht nur aktuelle Gefahren erkennen, sondern auch zukünftige Entwicklungen in ihre Planungen einfließen lassen. Diese Daten bilden eine solide Basis für die Entwicklung von Best Practices.
Aus den genannten Anwendungsszenarien lassen sich klare Maßnahmen ableiten, die deutschen Unternehmen einen strategischen Vorteil verschaffen. Vor dem Hintergrund der Klimaneutralitätsziele bis 2045 und der Anforderungen der deutschen Carbon Management Strategy wird die präzise Nutzung von Daten immer wichtiger.
Datenqualität und Governance sind dabei der Schlüssel. Unternehmen sollten ihre bestehenden Datenstrukturen überprüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Emissionsquellen erfasst werden. Eine schrittweise Integration von Return Period-Daten in bestehende Risikomanagement-Systeme hat sich als praktikabler Ansatz erwiesen. Der Einstieg kann beispielsweise mit der Analyse von Scope 1-, 2- und 3-Emissionen erfolgen, die dann mit historischen Klimadaten verknüpft werden.
Ein weiterer zentraler Punkt ist die Einbindung aller relevanten Stakeholder – von der Führungsebene bis hin zu operativen Teams. Es muss deutlich kommuniziert werden, wie Return Period-Analysen zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen beitragen. MULTIPLYE unterstützt dabei mit Beratungsleistungen, die komplexe Analyseergebnisse in verständliche Strategien übersetzen.
Im Bereich der Lieferkettenanalyse sind Return Period-Daten besonders nützlich, um klimabedingte Risiken bei Zulieferern zu bewerten. Dies wird vor allem durch das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz immer relevanter.
Zusätzlich sollten Unternehmen auf eine korrekte Dokumentation und Berichterstattung achten. Dazu gehört die Einhaltung deutscher Standards, wie die Nutzung von Dezimalkommas oder die Angabe von Emissionswerten in Tonnen CO₂e.
Schließlich können Benchmarking-Tools dabei helfen, die eigenen Analysen mit Branchenstandards zu vergleichen. MULTIPLYE entwickelt entsprechende Funktionen, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Leistungen sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene einzuordnen. Solche Tools bieten eine wertvolle Orientierung und fördern den kontinuierlichen Verbesserungsprozess.
Return Periods ermöglichen es Unternehmen, Risiken im Zusammenhang mit ihrer CO₂-Bilanzierung präziser einzuschätzen. Sie liefern eine solide Grundlage, um klimabedingte Risiken zu bewerten und fundierte Entscheidungen für nachhaltige Strategien zu treffen. Die Plattform MULTIPLYE nutzt diese statistischen Methoden, um historische Klimadaten in umsetzbare Empfehlungen zu übersetzen, was die Genauigkeit der CO₂-Bilanzierung erheblich verbessert. Diese datenbasierte Herangehensweise hilft Unternehmen zudem, den steigenden regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden.
Die Integration von Return Period-Analysen in die MULTIPLYE-Plattform bietet deutschen Unternehmen einen klaren Vorteil: Automatisierte Analysen liefern präzisere Ergebnisse als manuelle Berechnungen. Vor allem angesichts der verschärften EU-Berichtspflichten wird diese Automatisierung zunehmend unverzichtbar. Neben technologischen Fortschritten spielt auch die Einhaltung neuer gesetzlicher Vorgaben eine immer größere Rolle.
Seit 2023 erweitert die CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) die Berichtspflichten für EU-Unternehmen deutlich. Etwa 50.000 Unternehmen in der EU sind betroffen, wobei die Richtlinie auch Aktivitäten entlang der gesamten Wertschöpfungskette umfasst. Unternehmen, die bereits unter dem deutschen CSR-RUG berichten, müssen ab 2025 erstmals nach CSRD-Vorgaben für das Geschäftsjahr 2024 berichten. In diesem Kontext sind Return Period-Analysen besonders hilfreich.
Unternehmen, die aktiv werden möchten, sollten zunächst ihre CO₂-Bilanzierungsanforderungen prüfen und festlegen, welche Emissionskategorien (Scope 1, 2 oder 3) relevant sind. MULTIPLYE unterstützt diesen Prozess durch eine umfassende Datenerfassung und -integration, die sich nahtlos in bestehende Systeme wie Energiemonitoring-Tools, Finanzsoftware und Beschaffungsplattformen einfügt.
Die Plattform erfüllt die Standards etablierter Frameworks wie das Greenhouse Gas Protocol und SBTi. MULTIPLYE bietet zudem flexible Preismodelle: Von einer kostenlosen 7-Tage-Testversion bis hin zur Premium-Version für 1.999 € jährlich, die eine vollständige KI-basierte CO₂e-Bilanz und persönliche Expertenberatung umfasst.
Ein wichtiger nächster Schritt für deutsche Unternehmen ist die Schulung ihrer Mitarbeiter im Umgang mit dem System und der Interpretation der Ergebnisse der Return Period-Analysen. Nach der Implementierung sollten Unternehmen das System regelmäßig überwachen und Emissionsfaktoren kontinuierlich aktualisieren.
Wie in den vorherigen Abschnitten beschrieben, bietet MULTIPLYE mit automatisierten Return Period-Analysen eine effektive Lösung für diese Herausforderungen. Diese Analysen sind ein zentraler Baustein für eine datenbasierte Nachhaltigkeitsstrategie, die deutschen Unternehmen hilft, ihre Klimaziele zu erreichen und gleichzeitig regulatorische Anforderungen zu erfüllen.
Return Periods bieten Unternehmen die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit und Stärke extremer Wetterereignisse wie Überschwemmungen oder Stürme besser einzuschätzen. Dadurch lassen sich Risiken genauer bewerten und gezielte Maßnahmen entwickeln, um potenzielle Schäden zu minimieren.
Mit diesen Daten können Unternehmen präventive Strategien entwickeln und robustere Infrastrukturen planen, die auf den spezifischen Wahrscheinlichkeiten solcher Ereignisse basieren. So können fundierte Entscheidungen getroffen werden, um Klimarisiken zu mindern und langfristig stabilere Geschäftsmodelle zu schaffen.
Die Einbindung von Return Periods in die CO₂-Bilanzierung ermöglicht es Unternehmen, Risiken und Emissionen genauer zu bewerten. Diese Methode trägt dazu bei, fundierte Entscheidungen zu treffen und Emissionen gezielter und effektiver zu steuern. Mit einer realistischen Einschätzung der Risikoexposition können Maßnahmen präziser geplant und umgesetzt werden.
Darüber hinaus erleichtert der Einsatz von Return Periods die Einhaltung von EU-Klimazielen und Vorschriften wie dem EU-Emissionshandelssystem (EU ETS). Unternehmen profitieren von einer besseren Transparenz und Nachvollziehbarkeit ihrer Klimastrategien – ein wichtiger Schritt zur Unterstützung der europäischen Klimaziele.
Rückkehrperioden beschreiben, wie oft ein bestimmtes Ereignis statistisch gesehen auftritt. Um diese Perioden zu berechnen, analysiert man historische Daten und setzt dabei häufig statistische Modelle wie die Weibull-Formel ein. Die Berechnung erfolgt, indem man die Anzahl der Beobachtungsjahre durch die Rangordnung des Ereignisses teilt.
Für präzise Ergebnisse wird angenommen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses über die Zeit hinweg konstant bleibt und nicht von vorherigen Ereignissen beeinflusst wird. Zudem werden Methoden wie empirische Ränge und Wahrscheinlichkeiten eingesetzt, um Unsicherheiten zu verringern und genauere Schätzungen zu erzielen.
Auf der Multiplye-Plattform werden diese Berechnungen genutzt, um Unternehmen dabei zu helfen, Risiken besser einzuschätzen und fundierte Entscheidungen im Bereich Nachhaltigkeit zu treffen.